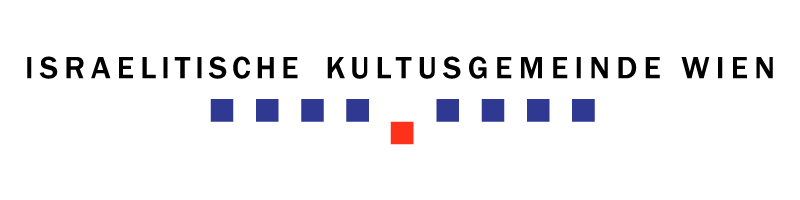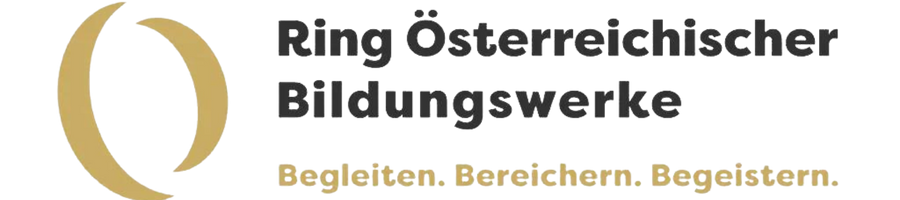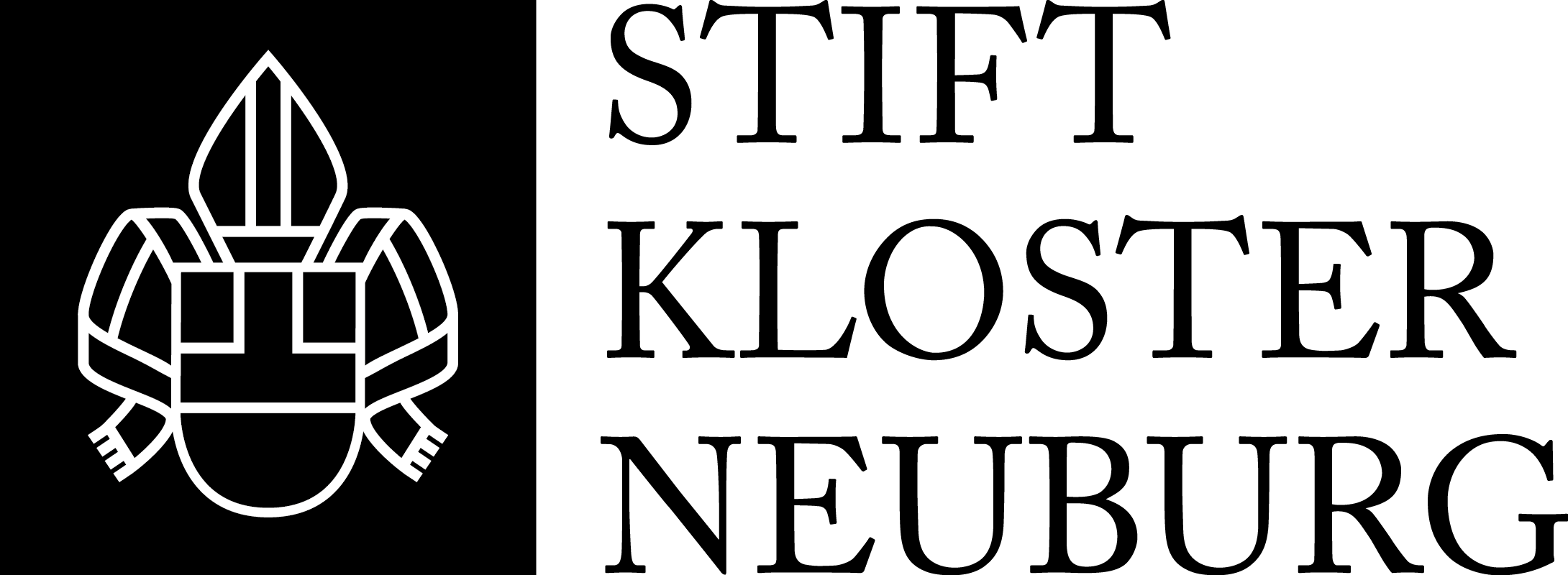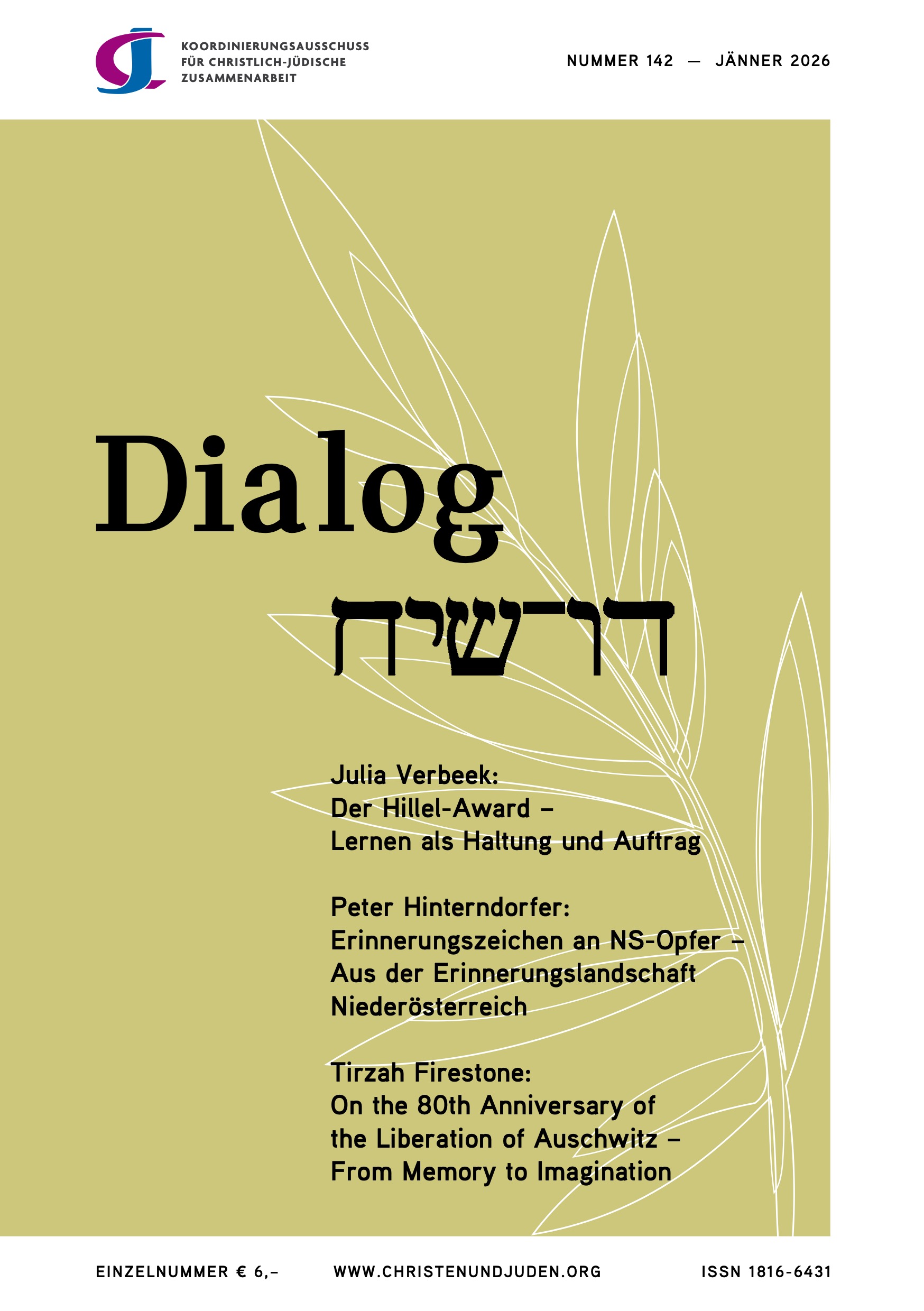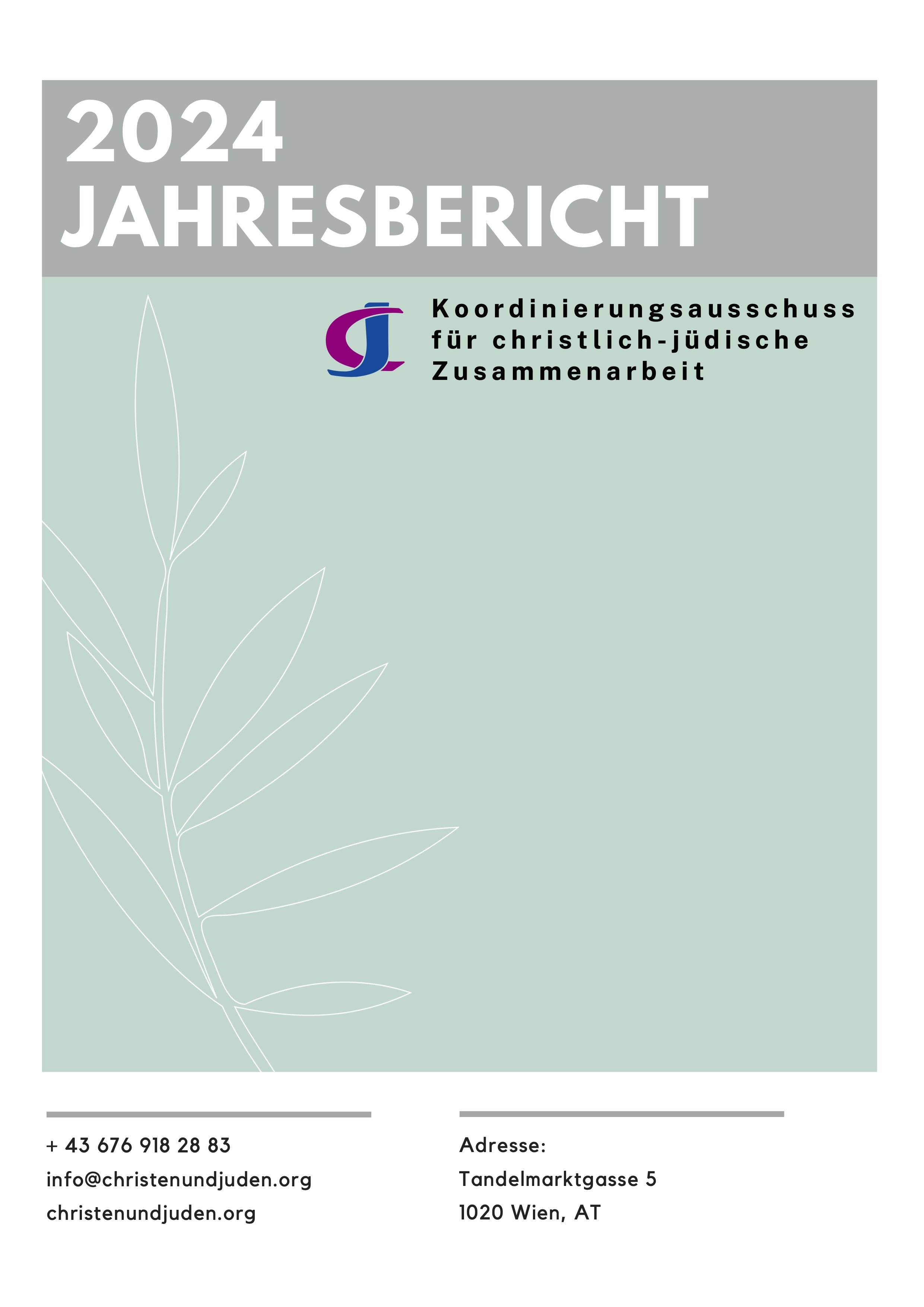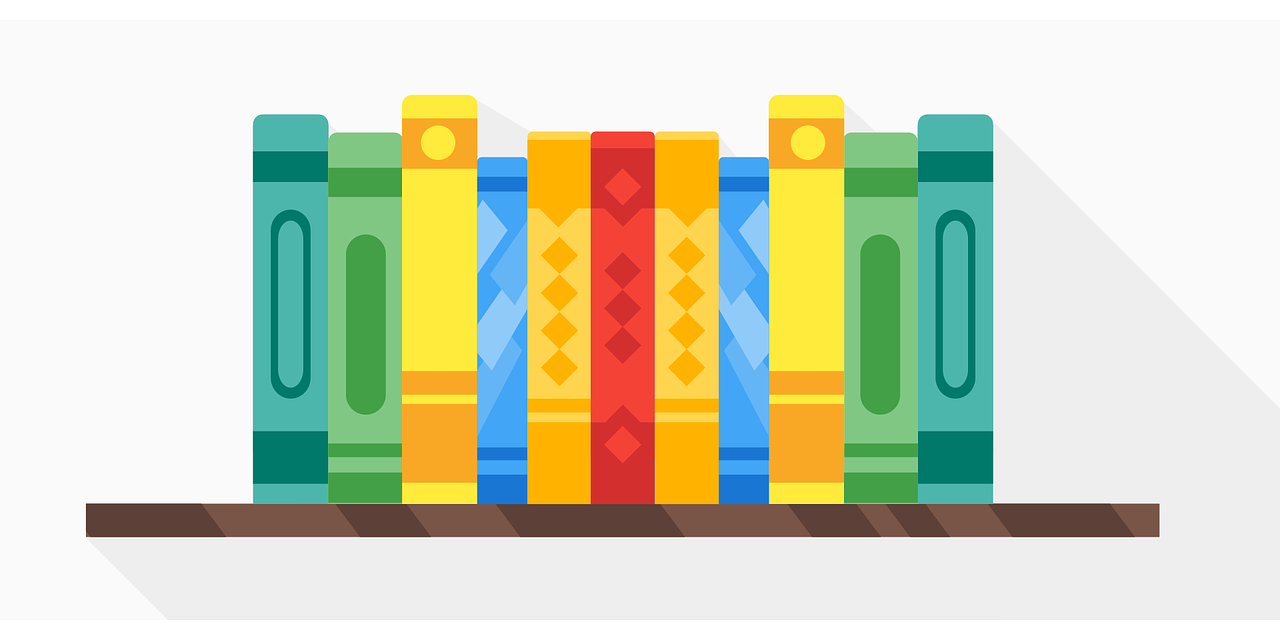1 Erfüllt vom Heiligen Geist, kehrte Jesus vom Jordan zurück. Er wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt, 2 vierzig Tage lang, und er wurde vom Teufel versucht. In jenen Tagen aß er nichts; als sie aber vorüber waren, hungerte ihn. 3 Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein, zu Brot zu werden. 4 Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 5 Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. 6 Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben; denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. 7 Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. 8 Jesus antwortete ihm: Es steht geschrieben: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. 9 Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich von hier hinab; 10 denn es steht geschrieben: Seinen Engeln befiehlt er deinetwegen, dich zu behüten; 11 und: Sie werden dich auf ihren Händen tragen, / damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. 12 Da antwortete ihm Jesus: Es ist gesagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. 13 Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel bis zur bestimmten Zeit von ihm ab. (Lk 4,1-13) Bibeltext... weniger
Wir bitten um Ihre Unterstützung
Spende
Nutzen Sie Ihr Smartphone um damit Bank-Überweisungen durchzuführen?
Wie das konkret geht? Sie als Spenderin/Spender lesen den hier aufscheinenden Code mit Smartphone und Banking App aus. Das mobile Zahlungs-formular ist dann in weniger als einer Sekunde vollständig und automatisch von der App erstellt - und noch dazu frei von Zahlenstürzen und Tippfehlern. Abschließend können Sie nun sogar noch Änderungen bei Ihrer Spendenüberweisung vornehmen: So etwa beim Spendenbetrag (Voreinstellung: EUR 0,-).
Schnell, praktisch, fehlerfrei und sicher: Ihre Spende an den Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit via Banking-App auf dem Smartphone.
Gerne senden wir Ihnen einen Zahlschein für Ihre Spende. Schicken Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Der Zahlschein kommt binnen weniger Tagen per Post zu Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Gemeinsam Erinnern, gemeinsam Gestalten:
Koordinierungsausschuss
für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Sei dabei für nur €35 im Jahr!
Auf dem Weg zu einer besseren Zukunft.

Unsere Sponsoren
NEUESTE BEITRÄGE
Aktuelles
Schauen Sie sich unseren reich gefüllten Veranstaltungskalender an und informieren Sie sich über spannende Veranstaltungen in ganz Österreich zum Thema Judentum, Dialog zwischen den Religionen, Sprachen und Antisemitismus.
Grußwort an die jüdische Gemeinde – Pessach und Ostern
Eine gemeinsame Hoffnung auf Befreiung und Leben
Pessach 5785/2025
Grußwort an die jüdische Gemeinde – Pessach und Ostern: Eine gemeinsame Hoffnung auf Befreiung und Leben
Wie in den meisten Jahren fallen heuer Pessach und - sogar für orthodoxen Christen - das Osterfest zusammen. Das erinnert uns inmitten einer von Unsicherheit und Leid geprägten Welt an eine tiefe Wahrheit: Wir glauben miteinander an die Kraft G'ttes, die befreit, Leben schenkt und Hoffnung erneuert und die uns als Geschöpfe G'ttes über alle Unterschiede hinweg verbindet.
Pessach ist das Fest der Befreiung. Es erzählt von G'ttes Treue, von der Rettung aus Sklaverei und Unterdrückung, von der Hoffnung auf eine Zukunft in Freiheit und Gerechtigkeit. Die Geschichte des Exodus ist nicht nur Erinnerung, sondern ist eine fortwährende Verheißung: G'tt sieht das Leiden seines Volkes und führt es aus der Unterdrückung heraus in das Gelobte (d.h. versprochene) Land.
Ostern ist das Fest der Auferstehung. Es verkündet, dass Gottes Liebe immer stärker ist als der Tod, dass das Licht die Finsternis überwindet. In diesem Jahr feiern Katholiken, Evangelische und Orthodoxe gemeinsam die Auferstehung Christi – ein starkes Zeichen der Einheit in einer Welt, die nach Frieden und Versöhnung dürstet.
In diesem Jahr begehen wir unsere Feste in einer Zeit tiefer Erschütterung. Der Krieg im Nahen Osten, das Wiederaufleben des Antisemitismus, die zunehmende Gewalt in vielen Teilen der Welt drohen den Glauben an Befreiung und hoffnungsvolles Leben zu erschüttern. Pessach und Ostern rufen dazu auf, nicht zu verzweifeln, sondern gemeinsam für Gerechtigkeit, Frieden und die Heiligung (Bewahrung) jedes einzelnen menschlichen Lebens einzutreten.
In diesem Jahr sind die Worte des Linzer Bischofs Manfred Scheuer eine wichtige Erinnerung: „Jesus ist für Christen ohne sein Judentum nicht zu haben.“ Diese Einsicht verpflichtet die Kirchen, ihre jüdischen Wurzeln nicht nur zu respektieren, sondern sie als untrennbaren Teil des eigenen Glaubens zu erkennen. Die Geschichte des Christentums ist ohne das Judentum nicht möglich – und unser Dialog darf nicht bei Worten stehen bleiben, sondern muss sich in echtem Respekt und entschiedener Solidarität zeigen.
Unsere jüdischen und christlichen Feste erinnern uns daran, dass G'ttes Handeln nicht in der Vergangenheit stehen geblieben ist. G'tt befreit – G'tt / Der Lebendige führt zum Leben – auch heute.
In diesem Geist wünschen wir von Herzen Chag Pessach kascher v'sameach.
Möge Pessach und Ostern ein Fest der Hoffnung für uns alle sein.
Mit aufrichtiger Hochachtung, großer Verbundenheit und geschwisterlichen Grüßen,
Martin Jäggle, Präsident
Margit Leuthold, Vizepräsidentin
Willy Weisz, Vizepräsident
Yuval Katz Wilfing, Geschäftsführung
Ferenc Simon, Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische Zusammenarbeit

Papst Leo XIV.: Ein Brückenbauer für Dialog, Frieden und Gerechtigkeit
Wir gratulieren Kardinal Robert Francis Prevost zur Wahl zum Papst und freuen uns über seine programmatischen Worte über „eine Kirche, die Brücken baut, die den Dialog sucht“.
Er studierte unter John T. Pawlikowsky, einem Pionier des christlich-jüdischen Dialogs. So sind wir zuversichtlich, dass Papst Leo XIV., der Papst Franziskus besonders verbunden war, dessen weichenstellendes Wirken im christlich-jüdischen Dialog fortführen und vertiefen wird – auch angesichts des 60. Jahrestages der Erklärung des II. Vatikanischen Konzils Nostra Aetate im kommenden Herbst.
Wir erbitten Papst Leo XIV. ein segensreiches Wirken als Brückenbauer (pontifex) für „Friede und Gerechtigkeit“.
Im Namen des Vorstandes des Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit:
Willy Weisz, Vizepräsident,
Margit Leuthold, Vizepräsidentin,
Martin Jäggle, Präsident,
Yuval Katz-Wilfing, Geschäftsführer,
Ferenc Simon Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische Zusammenarbeit
Polak neue Präsidentin des christlich-jüdischen Koordinierungsausschusses
Wiener Pastoraltheologin neue Präsidentin des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit - Koordinierungsausschuss bemüht sich seit 1956 um gute Beziehungen zwischen den Religionen
Die Pastoraltheologin Regina Polak ist neue Präsidentin des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit (KooA). Sie folgt in dieser Tätigkeit auf Martin Jäggle, der diese Aufgabe seit 2011 ausübte. "Ich weiß aus erster Hand, dass ich meinen christlichen Glauben nur im Dialog mit dem Judentum verstehen und leben kann", diese Erfahrung wolle sie auch anderen Menschen ermöglichen, so die Theologin gegenüber der Nachrichtenagentur Kathpress (Dienstag). Sorge bereite ihr der steigende Antisemitismus: "Niemals hätte ich damit gerechnet, dass Antisemitismus wieder so aufflammt wie seit dem 7. Oktober 2023 - sogar in mir nahen Milieus." Im 1956 gegründeten KooA finde sie einen Ort, "wo ich etwas zum Engagement gegen Judenfeindschaft unternehmen kann".
Die Wahl Polaks erfolgte am 18. November im Rahmen der Generalversammlung, die heuer unter dem Thema "Dem Bösen begegnen. Jüdische Spiritualität und jüdische Erfahrungen" stand. Rabbiner Schlomo Hofmeister und die Psychologin Clara Stepanow (ESRA) sprachen über spirituelle und psychologische Wege im Umgang mit Gewalt, Trauma und gesellschaftlichen Herausforderungen.
In ihrer ersten Erklärung dankte Polak ihrem Vorgänger Martin Jäggle: "Ich bin mir mehr als bewusst, in welche großen Fußstapfen ich trete, wenn ich die Nachfolge von Martin Jäggle als Präsidentin des Koordinierungsausschusses antrete." Der emeritierte Professor für Religionspädagogik habe sie in den christlich-jüdischen Dialog eingeführt, so die Theologin, die zugleich deutlich machte, das Amt auf eigene Weise gestalten zu wollen.
In Anbetracht des steigenden Antisemitismus sei eine kritische Reflexion bisheriger Strategien und Maßnahmen "gegen diese Pest" notwendig. Das wirksamste Gegengift bleibt laut Polak aber "die Freude am Dialog mit Jüdinnen und Juden in all ihrer Verschiedenheit".
Mit Blick auf zentrale Aufgaben des KooA erinnerte Polak an dessen Auftrag, die Kirchen zu erneuern, die Kenntnis des Judentums zu fördern, christliche Judenfeindschaft aufzuarbeiten, die Erinnerung an die Schoa wachzuhalten und Antisemitismus sowie Rassismus zu bekämpfen. Für Polak fügt sich dies nahtlos in ihre eigene theologische Arbeit: Die Erneuerung der Kirchen sei "die Hauptaufgabe meiner Disziplin in Forschung und Lehre", so die Pastoraltheologin. Dies könne "nur im Dialog mit dem Judentum geschehen" und sei zugleich "eine ökumenische Aufgabe". Sie freue sich auf die kommenden Jahre "in Kooperation mit einem hervorragenden Team" und verwies auf das Leitwort des KooA aus dem Buch Hosea (Hos 6,3-6): "Lasst uns Gott lernen!"
Ältestes Forum des christlich-jüdischen Dialogs
Der seit 70 Jahren bestehende Koordinierungsausschuss gilt als ältestes Forum des christlich-jüdischen Dialogs in Österreich und bemüht sich um gute Beziehungen zwischen den beiden Religionen. Kardinal Franz König (1905-2004) initiierte den Ausschuss 1956 auf Anregung von Prof. Kurt Schubert (1923-2007), dem Doyen der österreichischen Judaistik. Der Ausschuss trug nach der Schoah wesentlich dazu bei, dass ein neues Verhältnis zwischen Judentum und Christentum in Österreich möglich wurde. Die Arbeitsbereiche sind Dialog, Bildung, öffentliche Kommunikation und Wissenschaft.
Der Vorstand muss laut Statut zu je einem Drittel jüdisch, evangelisch und katholisch besetzt sein. Laut KooA-Website zählt der Koordinierungsausschuss aktuell mehr als 410 Mitglieder und 28 Partner. Neben KooA-Präsidentin Regina Polak sind Dechant Ferenc Simon und die Direktorin des Katholischen Bibelwerks, Elisabeth Birnbaum, die weiteren katholischen Vertreter im Vorstand. Von jüdischer Seite gehören Vizepräsident Willy Weisz sowie die Historiker Awi Blumenfeld und Mitchel Ash dem Vorstand an. Die evangelischen Vertreter sind Vizepräsidentin Margit Leuthold, Leonhard Jungwirth und Stefan Fleischner-Janits. Geschäftsführer des Koordinierungsausschusses ist seit 2020 der jüdische Religionswissenschaftler Yuval Katz betraut.
Der Ausschuss ist zudem auch im Kampf gegen Antisemitismus aktiv, als Mitglied des Forums gegen Antisemitismus und als Organisation, die in die Entwicklung von Strategien gegen Antisemitismus eingebunden war.
Quelle: Katholische Presseagentur KATHPRESS, Wien, Österreich
(www.kathpress.at)
Unbewussten und/oder unterschwelligen Antisemitismus in der Karwoche erkennen und vermeiden
Angesichts weltweit zunehmender Gewalt gegen jüdische Menschen und Einrichtungen sollten katholische Pfarren, Gemeinden und ihre Verantwortlichen besonders achtsam sein, keine expliziten oder impliziten Formen von Antisemitismus in Predigten, Liturgie oder kirchlichen Ritualen zu fördern. Dies ist eine Aufgabe, die das gesamte Jahr über wichtig ist, jedoch besondere Relevanz in der Karwoche hat. Diese Woche, die für Christen eine Zeit der Besinnung und Erneuerung ist, war in der Vergangenheit für jüdische Gemeinschaften oft eine Zeit von Angst und Gewalt.
(Priester) Leiter:innen von Gottesdiensten sollten sich der historischen Wurzeln von Antisemitismus bewusst sein, der häufig mit christlichen Erzählungen verknüpft wurde. Besonders die Karwoche war durch Predigten geprägt, wonach die Passionsgeschichte antijüdische Narrative enthält.
Historische Gefahren: Im Mittelalter wurden Juden in der Karwoche zu Opfern von Gewalt, oft angestachelt durch Predigten, die Juden kollektiv für den Tod Jesu verantwortlich machten.
Biblische Genauigkeit: Predigen Sie klar, dass Jesus und seine Anhänger Juden waren, die innerhalb der jüdischen Tradition lebten. Vermeiden Sie Formulierungen, die ein „Wir“ (Christen) gegen „Sie“ (Juden) implizieren oder suggerieren, dass das Christentum bereits zu Jesu Lebzeiten als eigenständige Religion existierte. Von Auferstehung als einer neuen, speziell und einzigartigen christlichen Erfahrung zu sprechen, ist falsch.
Achtsamkeit in der Liturgie
Die Liturgie ist ein zentraler Bestandteil des kirchlichen Lebens und eine intime, gemeinschaftliche Erfahrung. Gerade hier können antijüdische Stereotype oder Narrative unbemerkt Einzug halten.
Überprüfung der Sprache: Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Gebete und Einführungen keine negativen Darstellungen von Juden oder der jüdischen Tradition enthalten. Zum Beispiel sollte in Predigten und Einführungen zur Passionsgeschichte klar darauf hingewiesen werden, dass es ein falsches Verständnis ist, Juden kollektiv als „Gottesmörder“ zu diffamieren (z. B. Matthäus 27,25). Unterstreichen Sie, dass solche Anschuldigungen historisch falsch sind und über Jahrhunderte zu Gewalt gegen Juden geführt haben.
Der Gesang der Improperien am Karfreitag verdient besondere Beachtung: Hier finden Sie praktische Hinweise zu Improperien.
Symbolik von Dunkelheit und Licht: Osterrituale, die den Übergang von Dunkelheit zu Licht symbolisieren, sollten nicht so interpretiert werden, dass die Dunkelheit mit dem Judentum ("Altes" Testament) und das Licht mit dem Christentum (Neues Testament) gleichgesetzt wird.
Praktische Tipps zu Lichtweitergabe:
Die Osterkerze dient als Quelle für das Licht der anderen Kerzen. Zunächst entzünden die Ministranten ihre Kerzen an der Osterkerze. Anschließend geben sie das Licht an die versammelte Gemeinde weiter.
Beleuchtung der Kirche: Während oder unmittelbar nach dem Erklingen des Exsultet werden alle Lichter in der Kirche eingeschaltet.
Diese feierliche Handlung unterstreicht die universale Heilsbedeutung der Auferstehung Christi. Dadurch wird auch unbewusster Antisemitismus in der Liturgie vermieden: Die Symbolik von Dunkelheit und Licht wird nicht so interpretiert, dass Dunkelheit mit dem Judentum und Licht mit dem Christentum gleichgesetzt wird. Vielmehr steht die Dunkelheit für den Tod und die Abwesenheit Christi, die alle Menschen betrifft, während das Licht die Freude über die Auferstehung für die gesamte Menschheit symbolisiert.
Kontextualisierung von Schriftlesungen
Viele neutestamentliche Texte, insbesondere solche mit harscher Rhetorik gegenüber jüdischen Gruppen (z. B. in den Evangelien oder den Briefen), sollten in ihrer historischen Situation als innerjüdische Debatten des 1. Jahrhunderts erklärt werden.
Machen Sie deutlich, dass diese Texte keine Grundlage für dauerhafte theologische Vorwürfe gegen Juden sind.
Heben Sie hervor, dass die Verantwortung für die Kreuzigung Jesu bei den römischen Behörden lag und nicht bei „den Juden“ als Ganzes. Selbst für die römische Besatzungsmacht war Pontius Pilatus später nicht mehr tragbar: Wegen zu großer Grausamkeit in seiner Amtsführung wurde er abgesetzt.
Hier sind einige Beispiele für positive und theologisch verantwortungsvolle Formulierungen im Umgang mit Matthäus 27,25 („Sein Blut komme über uns und unsere Kinder“), die Missverständnisse vermeiden und den Vers richtig einordnen:
1. Den historischen Kontext betonen
„Matthäus 27,25 spiegelt eine spezifische Situation zur Zeit Jesu wider und darf nicht als allgemeine Schuldzuweisung an das jüdische Volk verstanden werden.“
„Der Vers ist eine juristische Redewendung der damaligen Zeit und nicht als Fluch zu deuten.“
„Die Evangelien erzählen und reflektieren konkrete Ereignisse und berichten nicht von einer kollektiven Schuld.“
2. Theologische Klärung
„Jesu Tod war kein Zufall, sondern Teil von Gottes Heilsplan für alle Menschen.“
„Das Blut Jesu ist nicht ein Zeichen der Verdammnis, sondern der Erlösung für die ganze Menschheit.“
„Jesus selbst lehrte Vergebung und forderte uns auf, unsere Feinde zu lieben – nicht, Schuld zuzuweisen.“
3. Vermeidung von Schuldzuweisungen
„Die Kirche lehnt die Vorstellung einer kollektiven Schuld des jüdischen Volkes an Jesu Tod entschieden ab.“
„Über Jahrhunderte wurde dieser Vers missbraucht, um Antisemitismus zu rechtfertigen – doch das widerspricht völlig der Botschaft Jesu.“
„Wir sind als Christen berufen, diesen Text im Licht der Liebe und Versöhnung zu lesen, nicht der Anklage.“
4. Die wahre Bedeutung von Jesu Blut hervorheben
„Das Blut Jesu steht für Leben und Heil – es ist ein Zeichen der Liebe Gottes zu allen Menschen.“
„Die Passionserzählung zeigt nicht, wer schuld ist, sondern wie weit Gottes Liebe für die Menschheit geht.“
„Jesu Blut ruft uns nicht zu Hass auf, sondern zur Versöhnung und zur Überwindung von Feindschaft.“
Hier finden Sie weitere praktische Hinweise zu: Christliche Liturgie im Angesicht des Judentums
Respekt vor jüdischen Ritualen
In der aufrichtigen Absicht, die jüdische Wurzel des Christentums zu würdigen, veranstalten einige Gemeinden christliche Pessach-Feiern (Seder), in denen christologische Bedeutungen in jüdische Rituale eingefügt werden. Auch die wohlmeinende Aneignung eines fremden Ritus ist respektlos, und die Benützung der äußeren Form kann einem Außenstehenden die Tiefe der Bedeutung nicht erschließen.
Stattdessen könnten Sie Rabbiner oder jüdische Gemeindemitglieder einladen, die Bedeutung von Pessach im Judentum zu erläutern. Eine gemeinsame Bildungsfeier wäre eine respektvolle Alternative.
Historische Forschungen machen klar, dass keine einfache Linie vom jüdischen Seder zum letzten Abendmahl Jesu gezogen werden kann.
Förderung christlich-jüdischer Verständigung
Predigen Sie nicht, dass der Bund Gottes mit den Juden aufgehoben wurde. Christen können ihre Teilhabe am Bund Gottes feiern, ohne die Treue Gottes zu seinem Bund mit dem jüdischen Volk zu leugnen.
Ermutigen Sie zu Dialog mit jüdischen Gemeinden, um ein besseres Verständnis der gemeinsamen Wurzeln und Unterschiede zu fördern.
Die Botschaft der Erlösung ohne Abwertung
Verkündigen Sie die Auferstehung Christi mit einer Sprache, die niemanden ausgrenzt oder verletzt. Besonders angesichts der schrecklichen Erfahrungen jüdischer Gemeinschaften in der Geschichte – von Pogromen bis hin zum Holocaust – ist es entscheidend, keine Worte oder Bilder zu verwenden, die antijüdischen Hass fördern könnten.
Weisen Sie darauf hin, das die Auferstehungserfahrung eine zutiefst jüdische Erfahrung ist: Wer dem Ewigen gegenüber treu ist, dem wird auch der Ewige stets treu sein. Weisheit 5,15: "Die Gerechten aber leben in Ewigkeit, der Herr belohnt sie, der Höchste sorgt für sie."
Erinnern Sie daran, dass es jüdische Menschen waren, die uns das Auferstehungszeugnis überliefert haben: Die Apostel, Paulus, Maria Magdalena. Wir Christ:innen sind dem Judentum zu höchster Dankbarkeit verpflichtet für dieses Zeugnis, für die Leben spendende Kraft des Einen und Ewigen Gottes.
Zusammenfassung
Die Verkündigung des Evangeliums und die Feier der Liturgie bieten die Chance, Liebe, Respekt und Versöhnung zu fördern. Dies kann nur gelingen, wenn bewusst darauf geachtet wird, historische und theologische Verzerrungen zu vermeiden, die zu Antisemitismus beitragen könnten. Die Botschaft der Auferstehung Christi sollte eine Botschaft der Hoffnung und Solidarität sein – frei von Abwertung und Verachtung.
Bücher-/Lesetipps
- Norbert Reck: Dem Juden Jesus auf der Spur
- Norbert Reck (Hrsg.), Paul Petzel (Hrsg.): Von Abba bis Zorn Gottes, Irrtümer aufklären – das Judentum verstehen
- Doron Kiesel (Hrsg.), Joachim Valentin (Hrsg.), Christian Wiese (Hg.): Jüdisch-christlicher Dialog. Ein Kompendium
- Christian Frevel/René, W. Dausner (Hrsg.): Schulter an Schulter
- Christian Rutishauser, Barbara Schmitz, Jan Woppowa (Hrsg.): Jüdisch-christlicher Dialog
- Joseph Sievers (Hrsg.), Amy-Jill Levine (Hrsg.), Jens Schröter(Hrsg.): Die Pharisäer - Geschichte und Bedeutung (Buch zur Vatikanischen Konferenz 2019)
Grußwort zu Chanukka und Weihnachten
15.-22.Dezember 2025
LICHT, ERINNERUNG UND GEMEINSAME VERANTWORTUNG
Chanukka und Weihnachten stehen in unterschiedlichen religiösen Traditionen, doch beide Feste rufen in ihrer eigenen Weise dazu auf, dem Licht Raum zu geben. In einer Zeit, in der Unsicherheit, Konflikte und Spaltungen zunehmen, erinnern uns diese Festtage an die Bedeutung von Orientierung, Mut und menschlicher Würde.
Chanukka erinnert an die Wiederweihe des Tempels und an den Einsatz für religiöse Freiheit. Die Lichter der Chanukkia stehen für Beharrlichkeit, Hoffnung und die Erfahrung, dass selbst so kleine Mittel wie Öl für einen Tag eine große Wirkung entfalten können. Dieses Fest bringt eine eigene, klare Botschaft in unsere Zeit ein: dass Vertrauen, Mut und die Wahrung spiritueller Identität auch unter widrigen Umständen Bestand haben können.
Weihnachten bezeugt in eigener Weise, dass Licht in die Welt kommt, Orientierung schenkt und den Blick auf das richtet, was Menschen miteinander verbindet und getragen sein lässt. Es lädt dazu ein, Hoffnung nicht aus den Augen zu verlieren und sich für eine Kultur des Miteinander einzusetzen, die alle Menschen in ihrer Würde achtet.
In ihrer Unterschiedlichkeit weisen beide Feste auf eine gemeinsame Verantwortung hin. Die jüdische und die christliche Tradition betonen, dass Licht nicht nur für die eigene Gemeinschaft bestimmt ist, sondern für die Welt, in der wir miteinander leben. 2025 fordert uns heraus, diese Verantwortung bewusst wahrzunehmen: durch Einsatz für Frieden, durch Schutz vor Antisemitismus und jeder Form von Ausgrenzung, und durch den Erhalt einer offenen und respektvollen Gesellschaft.
Der Dialog zwischen Jüdinnen und Juden einerseits und Christinnen und Christen andererseits bleibt dafür unverzichtbar. Er entsteht nicht von selbst, sondern wächst durch Begegnung, verlässliche Zusammenarbeit und gegenseitige Achtung. Als Koordinierungsausschuss sehen wir es als unseren Auftrag, diese Räume des Austauschs zu pflegen und zu stärken – gerade in Zeiten, in denen Vertrauen nicht selbstverständlich ist.
Mögen die Lichter von Chanukka Orientierung und Mut geben, und möge die weihnachtliche Botschaft Hoffnung und Zuversicht stärken.. Mögen beide Feste dazu beitragen, das Miteinander in unserer Gesellschaft zu vertiefen und Wege des Friedens offenzuhalten.
Wir wünschen ein freudiges Chanukka und ein gesegnetes Weihnachtsfest.
Chanukka sameach und gesegnete Weihnachten.
Margit Leuthold
Willy Weisz
Regina Polak
Martin Jäggle
Yuval Katz-Willfing
Ferenc Simon

Gemeinsamkeiten von Weihnachten und Chanukka
1. Fest der Lichter:
Beide Feste sind geprägt von Lichtern, die eine tiefere Bedeutung tragen. Während bei Weihnachten die Lichter des Weihnachtsbaums die Hoffnung und das Licht Christi symbolisieren, wird bei Chanukka die Chanukkia entzündet, um an das Wunder des Öls zu erinnern, das acht Tage brannte.
2. Zeit des Miteinanders:
Weihnachten und Chanukka sind Zeiten, in denen Familie und Freunde zusammenkommen, um Gemeinschaft zu erleben und einander Freude zu schenken.
3. Traditionen:
Rituale und Bräuche spielen bei beiden Festen eine zentrale Rolle: Weihnachtsgottesdienste, das Schmücken des Baumes zu Weihnachten; das Entzünden der Chanukkia, das Singen von Liedern und das Spielen des Dreidels bei Chanukka.
4. Botschaft der Hoffnung:
Beide Feste erzählen Geschichten des Glaubens und des Triumphs. Weihnachten feiert die Geburt Jesu Christi, die als Botschaft der Erlösung und Hoffnung für die Welt verstanden wird. Chanukka erinnert an den jüdischen Widerstand gegen die hellenistische Unterdrückung und die Wiederweihe des Tempels, ein Symbol des Lichts und der Hoffnung.
Unterschiede zwischen Weihnachten und Chanukka
1. Historischer Ursprung:
Weihnachten ist eines der zentralen Feste des Christentums und erinnert an die Geburt Jesu Christi, die als Beginn einer neuen Ära der Erlösung gilt. Chanukka hingegen hat seinen Ursprung in der jüdischen Geschichte und erinnert an den Sieg der Makkabäer über die Seleukiden und das Wunder des Öls im Tempel von Jerusalem.
2. Dauer und Zeitpunkt:
Weihnachten wird jedes Jahr am 25. Dezember - beginnend am Vorabend - gefeiert, am Ende des Advents, der Zeit der Vorbereitung. Das Fest wird acht Tage lang gefeiert, die Weihnachtszeit geht jedenfalls bis zum 6. Januar. Für jene, die sich am Julianischen Kalender orientieren wie z.B. einige orthodoxe Kirchen, sind die Festtage 13 Tage später. Chanukka dauert acht Tage, und sein fixer Beginn nach dem jüdischen Mondkalender am 25. Kislev variiert in Bezug auf den zivilen gregorianischen Sonnenkalender zwischen Ende November (äußerst selten) und dem 26. Dezember.
3. Symbolik:
Während Weihnachten stark auf die Geburt Jesu Christi und die Krippe ausgerichtet ist, steht bei Chanukka die Chanukkia (der Leuchter) im Mittelpunkt, die an den Sieg der Makkabäer und die wieder ermöglichte freie Religionsausübung im wieder geweihten Tempel zu Jerusalem erinnert.
4. Religiöse Bedeutung:
Weihnachten ist eines der wichtigsten Feste im christlichen Jahreskreis und tief in der Theologie verankert. Chanukka hingegen hat weniger spirituelles Gewicht im Judentum als Hochfeste wie Jom Kippur oder Pessach, wird aber als kulturelles und historisches Fest von großer Bedeutung gefeiert.

„Hillel Award“
Anlässlich des 27. Jänner 2026 (Gedenktag Befreiung Ausschwitz) schreibt der Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit den „Hillel-Award“ aus. Prämiert werden herausragende Abschlussarbeiten (ABA) und Diplomarbeiten (BHS), die einen thematischen Bezug und kritischen Zugang zu jüdischem Leben bzw. christlich-jüdischen Beziehungen in Gegenwart und Geschichte aufweisen.
Ziel des „Hillel Award“
ist die Würdigung und Sichtbarmachung vorwissenschaftlicher Leistungen und Perspektiven von Schülerinnen und Schülern in ganz Österreich. Der Preis soll dazu ermutigen, sich mit der Thematik jüdischen Lebens zu befassen und gegen Antisemitismus zu wirken.
Zielgruppe
sind 18 – 20jährige, die eine höhere Schule absolvieren.
Einreichungsschluss ist der 30. April 2026, die festliche Verleihung des Hillel-Award findet am 26. Mai 2026 statt.
Zur Unterstützung der Arbeiten gibt es begleitende Workshops:
• jeweils im Herbst für jene, die zum Haupttermin 2026 maturieren – heuer am 6. November 2025
• jeweils im Frühjahr für Schülerinnen und Schüler, die am Beginn ihrer Arbeiten stehen
Mitglieder der Jury
sind herausragende jüdische und christliche Fachleute.
Der Namensgeber Hillel
ist der legendäre jüdische Tora-Gelehrte „Hillel der Ältere“ aus dem ersten Jahrhundert vor der Zeitrechnung. Er galt als sanftmütig und geduldig. Im Talmud wird berichtet, dass er den Kern der Tora in einem Satz zusammengefasst hat. Er entspricht der sogenannten „Goldenen Regel“: „Was dir nicht lieb ist, das tue auch deinem Nächsten nicht an.“
Und er fügte hinzu: „Das ist die ganze Tora. Alles andere sind Hinzufügungen. Geh und lern sie!“
Der „Hillel Award“ wird jährlich vom Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit vergeben, jeweils am letzten Montag im Mai, zum zweiten Mal am 26. Mai 2026.
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
FAQs
Hillel-Award für Vorwissenschaftliche Arbeiten (AHS) und Diplomarbeiten (BHS)
Schüler:innen, die im Reifeprüfungsjahr 2025 eine vorwissenschaftliche Arbeit (AHS) oder eine Diplomarbeit (BHS) zum Themenbereich Jüdisches Leben bzw. christlich-jüdische Beziehungen in Gegenwart und Geschichte verfasst haben.
Die Arbeit muss mit „Sehr Gut“ beurteilt worden sein und folgende Kriterien erfüllen:
• Thematische Relevanz
• Verwendete Quellen
• Kritischer Zugang
• Methodisch-analytische Vorgangsweise
• Sprachliche und formale Qualität
Zur Unterstützung der Arbeiten gibt es begleitende Workshops:
• jeweils im Herbst für jene, die zum Haupttermin 2026 maturieren – heuer am 6. November 2025
• jeweils im Frühjahr für Schülerinnen und Schüler, die am Beginn ihrer Arbeiten stehen
• Einreichfrist: 30. April 2025
• Format: PDF
• Zusätzlich erforderlich: Stellungnahme der Betreuungsperson(en)
• Einreichung an: info@christenundjuden.org
Der Hillel-Award ist mit drei Preisen dotiert, insgesamt 1.500 €.
• Eine Jury wählt maximal 10 Arbeiten für die Shortlist aus.
• Die Autor:innen der ausgewählten Arbeiten werden (mit Begleitpersonen) zur feierlichen Preisverleihung eingeladen.
• Alle nominierten Arbeiten werden öffentlich gewürdigt.
• Anschließend werden die Preisträger:innen bekannt gegeben und erhalten den Hillel-Award.
Julia Verbeek, BA
julia.verbeek@univie.ac.at
Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.
Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.
Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.
Blocs Master Max Membership includes every single template, custom blocs, tutorial, course, library, and more. It also comes with a guaranteed fast response time and personal human support from Blocs Master.
Grußwort Rosch Haschana 5786

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der jüdischen Gemeinden,
Rosch Haschana eröffnet die Jamim Noraim, die „Ehrfurcht einflößenden Tage“, die in Jom Kippur münden. Diese Zeit ruft zur Umkehr, zur Selbstprüfung und zur Rückkehr zu Gott. Der Prophet Jesaja sagt: „Sucht den HERRN, solange er sich finden lässt, ruft ihn an, solange er nahe ist“ (Jes 55,6). In der jüdischen Tradition wird dieser Vers besonders auf die zehn Tage zwischen Rosch Haschana und Jom Kippur bezogen.
Zwei Zeichen prägen diesen Neubeginn in besonderer Weise:
- Der Klang des Schofars. Im Psalm heißt es: „Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes!“ (Ps 81,4). Maimonides erläutert in der Mischne Tora (Hilchot Teschuwa 3,4), dass der Schofar gleichsam zu den Schlafenden spricht: „Wacht auf aus eurem Schlaf und prüft eure Taten.“ Der Klang ruft zur Erinnerung, zur Umkehr und zur Rückbindung an den Bund zwischen G"tt und Israel.
- Der Apfel in Honig. Mit dem Eintauchen des Apfels verbindet sich der Wunsch: „Möge es Dein Wille sein, uns ein gutes und süßes Jahr zu erneuern.“ Dieses einfache Ritual macht Hoffnung schmeckbar. Es ist eine Geste, die Vertrauen und Zukunftshoffnung ausdrückt.
Für uns im christlich-jüdischen Dialog sind diese Symbole Einladungen zum respektvollen Hören, Wahrnehmen und Lernen. Sie führen uns vor Augen, dass Liturgie und gelebter Glaube dort besonders fruchtbar werden, wo Unterschiede nicht verwischt, sondern in gegenseitiger Achtung benannt werden.
Mit dieser Haltung wünschen wir Ihnen ein gesegnetes, gutes und süßes Jahr. Schana Towa uMetuka.
Martin Jäggle, Präsident
Margit Leuthold, Vizepräsidentin
Willy Weisz, Vizepräsident
Yuval Katz-Wilfing, Geschäftsführung
Ferenc Simon, Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische Zusammenarbeit
Grußwort zum 17. Jänner 2026 - Tag des Judentums
von Bischof Manfred Scheuer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Grußwort zum 17. Jänner 2026 - Tag des Judentums
von Bischof Manfred Scheuer
Tag des Lernens
Wien | 12. Jänner 2026 | 18:30 Uhr
Misrachi Synagoge, Judenplatz 8, 1010 Wien
Awi Blumenfeld lehrt über die Bedeutung des Gebets im Judentum. Gerhard Langer fungiert als Responsum.
Mit Grußworten von Bischof Petrosyan (ÖRKÖ) und Moderation von Regina Polak.
Anmeldung
Tag des Gedenkens
Wien | 15. Jänner 2026 | 19:00 Uhr
Festsaal der Bezirksvorstehung Alsergrund, Wien 9., Währingerstraße 43
Vereinssynagoge Müllergasse (u.a.)
Anmeldung Hauptprogramm
VORPROGRAMM: FÜHRUNG DURCH DIE “JÜDISCHE UNIVERSITÄT WIEN” - Em. Univ. Prof. Dr. MITCHELL ASH
17:45, Universität Wien - Arkadenhof
Anmeldung Vorprogramm
Tag des Feierns
Wien | 17. Jänner 2026 | 18:00 Uhr
Armenisch-apostolische Kirche Wien 3., Kolonitzgasse 11 (im Hof)
Ökumenischer Gottesdienst des ÖRKÖ
Thema: Lasst uns Gott lernen (Hosea 6,3-6)
Predigt: Dechant und Pfarrer Ferenc Simon
Tag des Judentums Linz | JUNG.engagiert.religiös. Glaubensidentitäten im Dialog.
Linz | 15. Jänner 2026 | 19:00 Uhr
Präsentation und Dialog von/mit jungen Vertreter:innen
folgender Projekte:
Likrat und Dialog:Abraham
Eintritt: Spenden erbeten
Anmeldung und Infos
…mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele…
Konzert-Lesung mit Kohelet3 und Maya Rinderer
Götzis | 16. Jänner 2026 | 19:30 Uhr
Anlässlich des Tages des Judentums laden die altkatholische, evangelische, katholische und die serbisch-orthodoxe Kirchen Vorarlbergs ein, sich gemeinsam von jüdischer Musik und Lyrik berühren zu lassen.
Kapelle des Bildungshauses St. Arbogast, Montfortstraße 88, A-6840 Götzis
Infos
Burgenland | Tag des Judentums 2026
Eisenstadt | 15. Jänner 2026 | 17:00 Uhr
Private Pädagogische Hochschule Burgenland, SR N1.2.05 (eh. SR 10), 2. Stock
Thomas-Alva-Edison-Straße 1
7000 Eisenstadt
Infos
Salzburg | heim@ ― jüdische identitäten
15. Jänner 2026 | 15:00-18:30 Uhr | Katholisch-Theologische Fakultät, Universitätsplatz 1., Hörsaal 101
Studiennachmittag: Vortrag und Podiumsdiskussion
Vortrag Daniel Gerson (Bern): Zwischen Selbstbestimmung und Religionsgesetz. Jüdische Identitäten im 21. Jahrhundert.
Podiumsdiskussion:
Rabbinerin Esther Jonas-Märtin (Leipzig)
Daniel Gerson (Bern)
Susanne Plietzsch, Mihály Riszovannij, Martin Rötting (Salzburg)
Anschließend Abendgebet im Sacellum
Weitere Infos
Freitag, 16. Jänner 2026 | 13.30-17.30 Uhr Katholisch-Theologische Fakultät | Universitätsplatz 1 | Hörsaal 107
Gesprächsrunde und gemeinsame Schabbatfeier
„Frag die Rabbinerin“ – Gesprächsrunde mit Rabbinerin Esther Jonas-Märtin,
Vorbereitung und Feier zur Begrüßung des Schabbats (Kabbalat Schabbat)
Anmeldung erbeten über: matthias.hohla@eds.at
Konzeption und Organisation: Matthias Hohla, Susanne Plietzsch, Martin Rötting
Weitere Infos
Innsbruck | Tag des Judentums 2026
Innsbruck | 17. Jänner 2026 | 19:00 Uhr
Haus der Begegnung, Rennweg 12,
Der Bischof der Diözese Innsbruck und der Superintendent der Evangelischen Kirche für Salzburg – , Tirol laden zum traditionellen Tag des Judentums ein, der (außer am Schabbat, heuer Mozei Schabbat) immer am 17. Jänner stattfindet. Organisiert wird die Veranstaltung vom Lokalkomitee christlich-jüdische Zusammenarbeit Tirol.
Anmeldung unter: hdb.kurse@dibk.at
Infos
Burgenland | Tag des Judentums 2026
Eisenstadt | 15. Jänner 2026 | 17:00 Uhr
Private Pädagogische Hochschule Burgenland, SR N1.2.05 (eh. SR 10), 2. Stock
Thomas-Alva-Edison-Straße 1
7000 Eisenstadt
Infos

MAIMONIDES LECTURES
21. Maimonides Lectures: Die 'Wiener Erklärung: Religionen für den Frieden'
Die 21. Maimonides Lectures widmen sich den Themen der Diplomatie, der Vermittlung und des Dialogs und fokussieren auf das Abkommen die 'Wiener Erklärung: Religionen für den Frieden', in der die Abrahamitischen Religionsgemeinschaften die gemeinsame Ablehnung von Aggression, Gewalt und Terrorismus ausdrücken.
Mittwoch 26.11.2025 , Dauer: 2 Tage MI 26.11. 2 Tage

AT19 1919 0000 0025 0613
Für Ihre Spende: QR-Code scannen, Betrag eingeben, überweisen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Dialog-Expertin
Nicht über, sondern mit Juden lernen
IKG-Vertreterin Freyer in "Sonntag"-Kommentar: Begegnung zwischen Christentum und Judentum muss auf Dialog, Bildung und Respekt basieren
Den "Tag des Judentums", den die Kirchen in Österreich jedes Jahr am 17. Jänner begehen, gilt es zu nutzen, um die Beziehungen zwischen Christen und Juden im Land zu vertiefen und zu stärken. Das betont die jüdische Politikwissenschafterin Jasmine Freyer in einem Gastkommentar in der aktuellen Ausgabe der Wiener Kirchenzeitung "Der Sonntag". Dabei wäre es ratsam, rund um den "Tag des Judentums" und darüber hinaus nicht ausschließlich über, sondern mit Jüdinnen und Juden zu lernen, so Freyer.

Christsein geht nicht ohne Bezug zum Judentum
Neue Präsidentin des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit in Kirchenzeitungs-Interview: Interreligiöser Dialog verpflichtend für Gläubige - Antisemitismus "wie ein Chamäleon" mit ständig änderndem Erscheinungsbild
Christsein geht nicht ohne Bezug zum Judentum. Das betont die neue Präsidentin des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Prof. Regina Polak, im Interview mit der Kooperationsredaktion der heimischen Kirchenzeitungen. Polak ist Professorin für Praktische Theologie und Interreligiösen Dialog an der Universität Wien. Im November wurde sie zur Präsidentin des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit gewählt. Sie äußerte sich anlässlich des "Tages des Judentums", den die Kirchen am 17. Jänner begehen.

Gottesdienst feiern angesichts des Judentums
Ein Beitrag von Bischof Manfred Scheuer zum "Tag des Judentums" 2026
Zum heurigen „17. Jänner – Tag des Judentums“ möchte ich an eine Tagung erinnern, die das Österreichische Liturgische Institut im vergangenen Herbst im Salzburger Bildungshaus St. Virgil veranstaltet hat: "Gepriesen sei der G'tt Israels. Liturgie, Verkündigung und Glaubensvermittlung im Angesicht des Judentums". Zum Kern kirchlicher Identität gehört der Gottesdienst: Wir müssen uns bewusst sein, wie wir uns dabei regelmäßig ganz innig auf das Judentum einlassen. Dies bewusst wahrzunehmen und darüber zu reflektieren ist Voraussetzung, um unseren eigenen Glauben verstehen, ja leben zu können. Gerade dazu soll der Tag des Judentums als Tag des Lernens ermutigen.

Christlich und sensibel für das Judentum – nicht Widerspruch, sondern Anspruch – Bibel heute zeigt, wie es in der Praxis gehen kann!
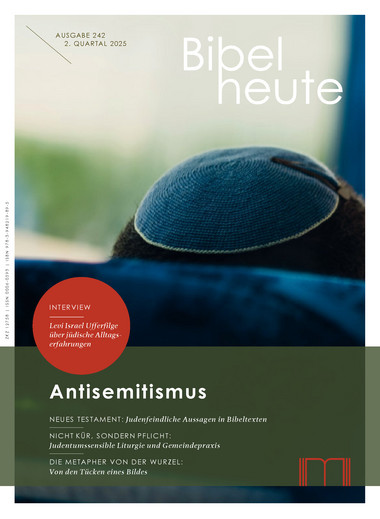
Der Gott der Liebe ist keine Erfindung Jesu und kein Alleinstel-lungsmerkmal des Christentums. Tatsächlich besteht die christliche Bibel zu mehrals zwei Dritteln aus jüdischen Texten. ... Dennoch sind judenfeindliche Auslegungenund antisemitische Tendenzen in christlicher Theologie, kirchlicher Praxis und Ge-sellschaft bis heute stark verbreitet, nehmen sogar zu. Die aktuelle Ausgabe von Bi-bel heute (Nr. 242) bezieht eindeutig Position: Eine judentumssensible Theologie undGemeindepraxis ist für Christinnen und Christen nicht Kür, sondern Pflicht!

Mechaye Hametim
Der die Toten auferweckt: Bedenktage zum Gedenken der Novemberpogrome 1938
Zum 87. Mal jähren sich heuer die Gräuel der Novemberpogrome: Alle jüdischen Bethäuser Wiens (mit Ausnahme des Stadttempels) wurden in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 zerstört. Seit vielen Jahren erinnert die Gemeinde St. Ruprecht in Kooperation mit anderen christlichen Institutionen in den Bedenktagen „Mechaye Hametim“ an diese Ereignisse und die Schoa – auch und gerade im Wissen um die Mitverantwortung von Christinnen und Christen dabei.
Otto Friedrich

Wir möchten alle christlichen Gemeinden herzlich einladen, sich der Fürbitte anzuschließen und sie in den Gottesdienst aufzunehmen:
Channukka
Fürbitte (15.-22. Dezember 2025)
Wir beten für das Wohlergehen der Jüdinnen und Juden dieser Stadt. Sie zünden in diesen Tagen die Chanukka-Lichter als Erinnerung an den siegreichen Befreiungskampf der Makkabäer, die Wiedereinweihung des Tempels zu Jerusalem und all die Wunder, die der Ewige Seinem Volk Israel widerfahren hat lassen. Wir bitten Ihn Seine Hand weiter schützend über sie zu halten.

Abschied von Béla Varga
Die Seelen der Gerechten aber sind in Gottes Hand
und keine Folter kann sie berühren.
In den Augen der Toren schienen sie gestorben,
ihr Heimgang galt als Unglück,
ihr Scheiden von uns als Vernichtung;
sie aber sind in Frieden.
In den Augen der Menschen wurden sie gestraft;
doch ihre Hoffnung ist voll Unsterblichkeit.
Weisheit 3
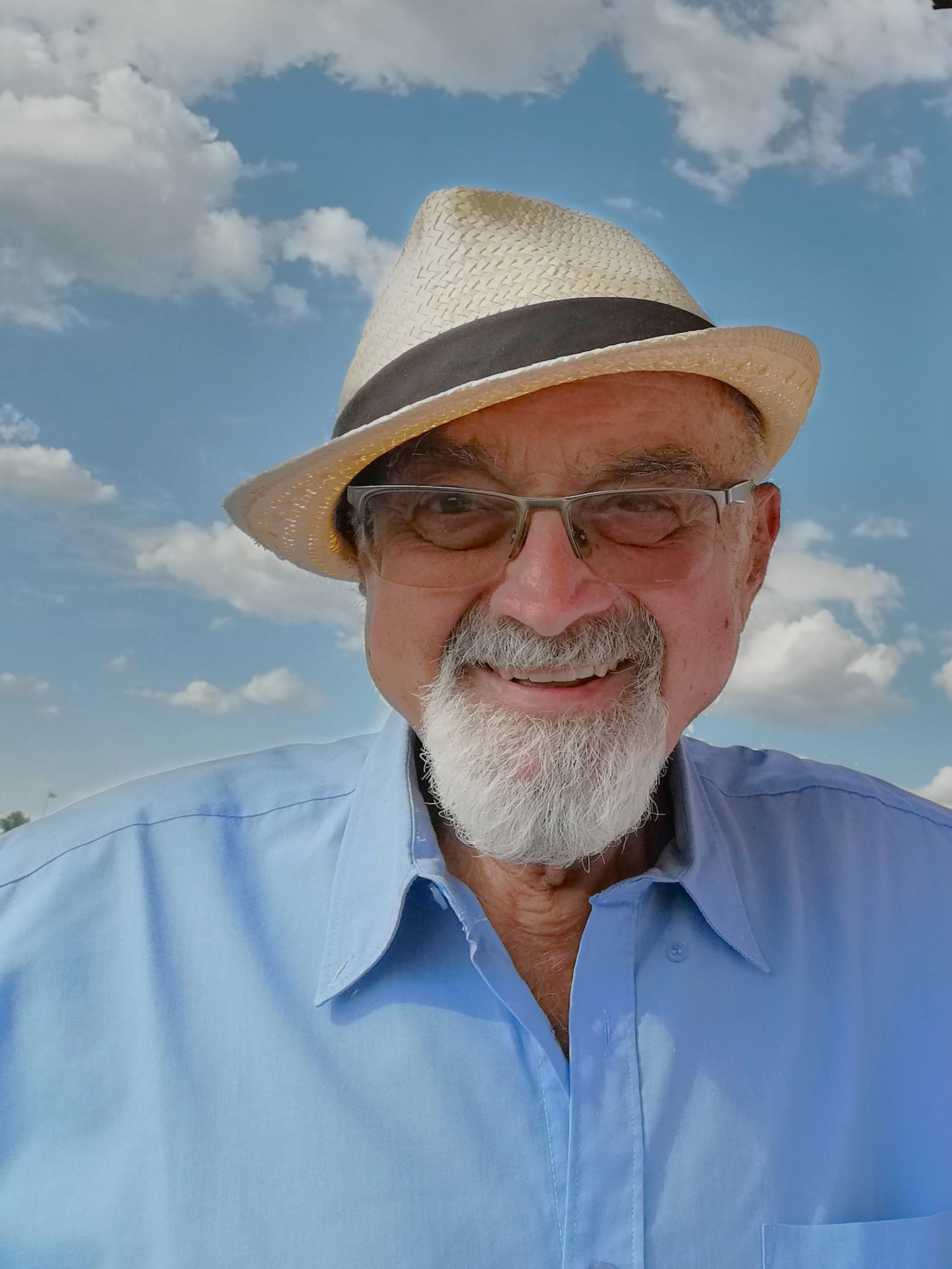

Liturgiehilfe zum 9. November 2025
Hochfest der Weihe der Lateranbasilika und Gedenken an die Pogromnacht 1938
Der 9. November 1938 war ein Tag der Gewalt gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger, ihre Versammlungsorte, ihre Würde und ihr Leben. In Wien wurden Synagogen zerstört – nicht „Tempel“ im alttestamentlichen Sinn, sondern lebendige Orte des Lernens, Betens und Zusammenlebens.
Diese Liturgiehilfe verbindet das Hochfest der Lateranbasilika mit dem Gedenken an diese Nacht. Sie lädt ein, die Erinnerung in das Gebet aufzunehmen – mit theologischer Sorgfalt, frei von Antijudaismus, und in der Haltung der Demut und Mitverantwortung.
Die Bausteine dieser Hilfe können je nach liturgischer Form angepasst und ergänzt werden.

Bücherflohmarkt der Bibliothek für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Unsere Bibliothek für christlich-jüdische Zusammenarbeit lädt Sie herzlich zu einem Bücherflohmarkt ein! Wir bieten eine Auswahl an Büchern aus den Bereichen Theologie, Geschichte, interreligiöser Dialog und Kultur, die aufgrund von Duplikaten in unseren Regalen Platz machen dürfen.
Eine vollständige Liste der Bücher steht Ihnen online zur Verfügung. Stöbern Sie bequem von zu Hause oder besuchen Sie uns vor Ort, um spannende Werke zu entdecken. Jeder Kauf unterstützt unsere Arbeit für Verständigung und Zusammenarbeit.
Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
am 18. November 2025, 18.00 Uhr
im Pfarrsaal der Lutherischen Stadtkirche Wien 1., Dorotheergasse 18
Thema: Dem Bösen begegnen. Jüdische Spiritualität und jüdische Erfahrungen
Referent:innen:
Rabbiner Schlomo Hofmeister MSc, seit 2008 Gemeinderabbiner von Wien
DDr. Clara Stepanow, ESRA-Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin
Moderation: Dr. Margit Leuthold, Pfarrerin i.R., jahrelang am AKH Krankenhausseelsorgin

Jüdische und christliche Feste
Herkunft - Feier - Spiritualität

Christliche Feste werden gerne auf jüdische Wurzeln oder Überformungen älterer Traditionen zurückgeführt. Trotz biblischer Verankerung beider ist jedoch die christliche Neudeutung der Feiern und Feste Israels weit seltener als die eigenständige Entwicklung da wie dort.
Themen:
Festtage und -zeiten | Schabbat & Sonntag | Helle Freude: Chanukka & Weihnachten | Von der Schande zum Ruhm: Pessach-Sukkot & Ostern | Gottes Gabe: Schawuot & Pfingsten | Versöhnung und Neuanfang: Rosch ha-Schana & Yom Kippur & Simchat Tora

Der "Hillel Award" für Maturantinnen und Maturanten

Am 22.6.2025 7.05 Uhr ist auf Ö1, Lebenskunst, ein ausführlicher Beitrag Wissen und Respekt fördern - Der "Hillel Award" für Maturantinnen und Maturanten

VERSCHOBEN: Jüdisches Straßenfest
2025 am Judenplatz
Mit koscherem Streetfood, Tanz- sowie Kinderprogramm und Live-Musik bieten jüdische Vereine und Institutionen Einblick in ihr Schaffen.
Die Teilnahme ist kostenlos; aus Sicherheitsgründen bitte einen Lichtbildausweis mitführen.
Das für kommenden Sonntag (22. Juni) angesetzte Straßenfest wird verschoben. Diese Entscheidung wurde nicht sicherheitsbasiert getroffen. Der Schutz dieser Veranstaltung hätte gewährleistet können! Die Verschiebung ist aus zwei Gründen erfolgt: Erstens weil uns nicht zum Feiern zumute ist, während unsere Familien und Freunde in Israel in Schutzräumen ausharren und um ihr Leben bangen und zweitens einige Künstler aus Israel kommen und das Land aktuell nicht verlassen können. Die Verschiebung erfolgt in Solidarität mit den Menschen in Israel-
Quelle: ikg-wien.at

Hillel-Award 2025 vergeben
Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit zeichnete Schülerarbeiten aus, die sich mit jüdischem Leben in Österreich und Einsatz gegen Antisemitismus befassen
In Wien wurde am Montagabend erstmals der "Hillel-Award" vergeben. Prämiert wurden im Rahmen einer Feierstunde im Gemeindezentrum der Israelitischen Kultusgemeinde Wien herausragende vorwissenschaftliche Arbeiten von Schülerinnen und Schülern.

Die Begriffe für "Auferstehung" in der Hebräischen Bibel und im Griechischen Neuen Testament: Eine theologische und historische Analyse
Interview mit Rabbiner Yuval Katz: Jüdische und griechische Perspektiven auf die Auferstehung
Von Ferenc Simon Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische Zusammenarbeit
Ich: Yuval, lass uns über die Auferstehung in der jüdischen Tradition sprechen. Gibt es dafür überhaupt einen Begriff in der Hebräischen Bibel?

Die Hoffnung über den Tod hinaus
Ein Gespräch mit Willy Weisz über die Ursprünge des jüdischen Auferstehungsglaubens
Von Ferenc Simon Diözesanbeauftragter für die christlich-jüdische Zusammenarbeit
Der jüdische Glaube an ein Leben nach dem Tod ist vielschichtig – und seine Geschichte reicht weit zurück. In einem Gespräch mit Willy Weisz, dem jüdischen Vizepräsidenten des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit und österreichischem Vertreter beim Internationalen Rat der Christen und Juden, wird deutlich, wie entscheidend die Zeit der Makkabäer (2. Jh. v. Chr.) für die Entwicklung des Auferstehungsgedankens war.

Stadtpaziergang - jüdische Leopoldstadt
Zeit und Ort
23.04.2025, 15 Uhr
Lessing Statue - Judenplatz
(Dauer: circa 2 Stunden)
Kosten: Frei für Mitglieder, sonst 15€.
Wir laden euch herzlich zu einem besonderen Stadtspaziergang durch die jüdische Leopoldstadt ein! Die Leopoldstadt in unserer Stadt ist ein historisch bedeutsamer Ort mit einer reichen jüdischen Geschichte und Kultur, die es zu entdecken gibt.

Christliche Liturgie im Angesicht des Judentums
Im Jahr 2000 hat die Arbeitsgruppe "Fragen des Judentums" der Deutschen Bischofskonferenz eine pastorale Handreichung erstellt. Sie bietet Einführungen in die Schriftlesungen der österlichen Bußzeit und der Heiligen Woche, mit dem Ziel, antisemitische und anti-jüdische Bezüge in der Liturgie zu vermeiden und ein respektvolles Miteinander zu fördern.

LEBENSKUNST 9.3.2025,
MARTIN JÄGGLE
Aspekte der Bibel – Lk 4,1-13
Nach der Tradition wird der unbekannte Verfasser des Evangeliums, das am 9. März in katholischen Gottesdiensten gelesen wird, Lukas genannt.

Tag des Judentums 2025 an der PPH Burgenland
Im Jahr 2000 hat der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich den 17. Jänner als besonderen Gedenktag eingeführt: den „Tag des Judentums“. Zu diesem Anlass sollen die gemeinsamen Wurzeln von Christentum und Judentum ebenso thematisiert werden wie das vielfache Unrecht, das Menschen jüdischen Glaubens in der Vergangenheit zuteil wurde. An der PPH Burgenland wurde der 26. Tag des Judentums mit einem Kurzsymposium begangen, das im Zeichen der Geschichte des Judentums stand.

Wir möchten alle christlichen Gemeinden herzlich einladen, sich der Fürbitte anzuschließen und sie in den Gottesdienst aufzunehmen:
Sukkot
Fürbitte (16.-23. Oktober oder am Sonntag den 20. Okober 2024/5785)
Herr des Universums, als unsere Vorväter die Wüste Sinai (vor ihrem Eintritt in das Land Israel) durchquerten, umringten und überschwebten sie die wundervollen Wolken der Herrlichkeit und schirmten sie von allen Gefahren und Unannehmlichkeiten der Wüste ab. Seither gedenkt Dein Volk Deiner Güte und beteuert erneut sein Vertrauen in Deine Fürsorge, indem es während des Sukkot-Festes in Hütten wohnt. Sei Du ihm Schutz und Schirm.

Wir möchten alle christlichen Gemeinden herzlich einladen, sich der Fürbitte anzuschließen und sie in den Gottesdienst aufzunehmen:
Jom Kippur
Fürbitte (12. Oktober oder am Sonntag den 13. Oktober 2024/5785)
Zur Zeit des Versöhnungstages Jom Kippur bitten wir Dich, Gott, Dein zu Dir umkehrendes Volk Israel in Barmherzigkeit anzunehmen. Wende Dich auch uns Menschen zu in Milde und Liebe, erhöre unsere Bitten und besiegle den Eintrag im Buch des guten Lebens.

Wir möchten alle christlichen Gemeinden herzlich einladen, sich der Fürbitte anzuschließen und sie in den Gottesdienst aufzunehmen:
Rosch ha-Schana
Fürbitte (2-4. Oktober oder am Sonntag den 6. Oktober 2024/5785)
Am Beginn des jüdischen neuen Jahres, am Fest Rosch HaSchana, bitten wir Dich Allmächtiger/Gütiger/Herr, segne die Juden und Jüdinnen, wo immer sie sich aufhalten. Möge das Jahr 5785 gut und süß werden. Denke an uns alle, damit wir leben, und schreibe uns (für ein gutes Leben) ins Buch des Lebens ein.
Wir sind stolz darauf, seit Jahrzehnten eine auch formell gleichberechtigte Zusammenarbeit von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Religionsgemeinschaften erfolgreich zu pflegen. Diese Form der interreligiösen Partnerschaft ist in unserem Land einzigartig.
Wir über uns
Vorstand, Geschichte, Persönlichkeiten
INTERNATIONAL CONFERENCE – SALZBURG 2024
BILINGUAL ENGLISH - GERMAN
"Be Holy, because I, the Lord, Your God, am Holy" (Wajikra / Leviticus 19:2)
Holiness: A Religious Imperative and Moral Obligation?
Sunday, June 23 - Wednesday, June 26
Before you register for the conference please read the "General Information" carefully!
Registration FormICCJ Jahreskonferenz in Salzburg thematisiert „Heiligkeit"
Anmeldung noch bis zum 23. Mai 2024.
Die Jahreskonferenz des Internationalen Rates der Christen und Juden (ICCJ), der Dachorganisation von weltweit 34 nationalen Organisationen des christlich-jüdischen Dialogs, findet in diesem Jahr vom 23. bis 26. Juni in Salzburg statt. Das Thema der diesjährigen Konferenz lautet: "‘Be Holy, because I, the Lord, Your God, am Holy‘ (Wajikra / Leviticus 19:2) - Holiness: A Religious Imperative and Moral Obligation?“ („‘Seid heilig, denn ich, der Herr und euer Gott ist heilig‘ [Wajikra/Levitikus 19:2‘ – Heiligkeit: Ein religiöser Imperativ und eine moralische Verpflichtung?“).
Während der dreieinhalbtägigen Konferenz werden Hauptvorträge und Plenarsitzungen zum Thema sowie eine Reihe von interaktiven Workshops, Besichtigungen und Exkursionen angeboten. Organisiert wird die Konferenz in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit, Österreich, und der Paris Lodron Universität Salzburg. Während der Konferenz werden Simultanübersetzungen in Englisch und Deutsch angeboten.
Gemeinden
Pfarren
Tag des Judentums
Israelsonntag
Wanderausstellung
ReferentInnenvermittlung
Aufarbeitung
Fürbitten
Great Ideas - Das Spiel - Dialog Abraham
Interview über
das Kartenspiel zum Anhören
Kartenspiel
Spielerinnen: 1-15 Dauer: ~1h
Erste Runde - Einführung
Jede/r Spieler/in wählt eine Karte (oder zwei, je nach Teilnehmerzahl) und erklärt, warum sie ausgewählt wurde (bei zwei Karten wird auch der Zusammenhang zwischen beiden erklärt). Zu diesem Zeitpunkt erhält jede/r Spieler/in eine „Spielgeld“ für jede gewählte Karte (kann ein Bonbon, ein Apfel, eine Nuss oder etwas Ähnliches sein ...)
Zweite Runde - Interaktion
Jeder/ Spieler/in muss sein „Geld“ verwenden, um jemand anderen eine Frage zu stellen. Dies kann erreicht werden, indem man die Frage auf ein Blatt Papier neben der Karte schreibt und das „Geld“ dem Besitzer/der Besitzerin der Karte gibt.
Dritte Runde - Diskussion
Jede/r Spieler/in wählt aus den gestellten Fragen eine aus und beantwortet sie. Der Fragesteller der gewählten Frage erhält eine weitere „Geldeinheit“ von der Bank.
Vierte Runde- Resümee/Baum des Wissens
Die interessanteste Karte (die mit den meisten Fragen) wird als Stamm des Baumes verwendet (auf den Tisch gelegt). Jeder Spieler sollte je nach Spielzug seine Karte(n) im Verhältnis zu den bereits platzierten Karten platzieren und die Beziehung zwischen den Ideen erklären. Gelingt es dem Spieler nicht, die Karte zu platzieren oder den Zusammenhang zu erklären, wird ihm eine „Geldeinheit“ abgenommen.
Der/Die Spieler/in mit dem meisten „Geld“ gewinnt den großen Preis: traditionell Honig, Bamba, Afikoman …
Das Spiel kann nach jeder Runde enden, abhängig von der vorgegebenen Zeit und dem Spielfortschritt.
First-class services for first-class clients.
Begegnen.
Brücken des Verstehens: Juden und Christen im Dialog für gegenseitigen Respekt
Christlich-jüdische Verständigung ist ein sehr vielfältiges Aufgabengebiet. Was unsere Initiative in Österreich - einem besonderen historischen Ort - dazu beiträgt, stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor.

Teilen.
Gemeinsam Erben, Werte teilen - Einheit in christlich-jüdischer Verbundenheit.
Heute sind wir hauptsächlich in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Dialog öffentlich wirksam. In Kooperation mit Bildungseinrichtungen wie der Kirchlich Pädagogischen Hochschule Wien/Krems oder dem Jüdischen Institut für Erwachsenenbildung werden zahlreiche Seminare und Vorträge gestaltet. mehr...
Unterstützen.
Gemeinsam Wirken, Verständnis fördern – Brücken bauen im christlich-jüdischen Dialog.
Wir sind die einzige aus dem Bereich der Kirchen hervorgegangene Organisation, die sich ausschließlich dem Dialog zwischen Christinnen, Christen und Jüdinnen und Juden widmet. Lokale Komitees arbeiten in Innsbruck, Salzburg, Linz, Eisenstadt und Graz; durch die Mitgliedschaft im International Council of Christians and Jews und zahlreiche internationale Kooperationen hat der Koordinierungsausschuss nicht nur Österreich im Blick.

Was über uns gesagt wird
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Eldar Gezalov
Eldartech, Inc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et.
Eldar Gezalov
Eldartech, Inc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Eldar Gezalov
Eldartech, Inc.
Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Eldar Gezalov
Eldartech, Inc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Eldar Gezalov
Eldartech, Inc.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Eldar Gezalov
Eldartech, Inc.
Frequently Asked Questions
Read the answers to your questions.
First question about a service or something?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
What about the second question you want to ask?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Let’s put another question here, the good one?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
This is a very good question, I can’t pass on that?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Lasst uns Gott lernen
Hosea 6,3-6
ZVR: 027485643
Copyright © 2026 CJ