Wir bitten um Ihre Unterstützung
Spende
Nutzen Sie Ihr Smartphone um damit Bank-Überweisungen durchzuführen?
Wie das konkret geht? Sie als Spenderin/Spender lesen den hier aufscheinenden Code mit Smartphone und Banking App aus. Das mobile Zahlungs-formular ist dann in weniger als einer Sekunde vollständig und automatisch von der App erstellt - und noch dazu frei von Zahlenstürzen und Tippfehlern. Abschließend können Sie nun sogar noch Änderungen bei Ihrer Spendenüberweisung vornehmen: So etwa beim Spendenbetrag (Voreinstellung: EUR 0,-).
Schnell, praktisch, fehlerfrei und sicher: Ihre Spende an den Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit via Banking-App auf dem Smartphone.
Gerne senden wir Ihnen einen Zahlschein für Ihre Spende. Schicken Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse. Der Zahlschein kommt binnen weniger Tagen per Post zu Ihnen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bildung für Verständnis, Respekt für Tradition: Gemeinsam im Zeichen des Judentums.
Veranstaltungen
Tag des Lernens
Brücken bauen durch Wissen: Tag des Judentums verbindet.
Tag des Gedenkens
Geschichte ehren, Gegenwart schätzen: Gemeinsam im Zeichen des Judentums.
Tag des Feierns
Dialog der Kulturen: Tag des Judentums als Brücke zwischen Gestern und Heute.
Liturgische Elemente
Respekt für Vielfalt, Wertschätzung für Tradition: Judentum im Herzen.
Entstehung & Bedeutung
Brücken bauen durch Wissen: Tag des Judentums verbindet.
Links und Literatur
Ein Tag der Einheit, Toleranz und Verständigung: Tag des Judentums.
Seit über 20 Jahren begehen die Kirchen Österreichs jeweils am 17. Jänner den "Tag des Judentums". Als Gedenktag im Kirchenjahr führte der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) diesen Tag ein. Christinnen und Christen sollen ihrer Wurzeln im Judentum und ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusstwerden. Zugleich lädt dieser Tag ein, an jüdischen Menschen und ihrem Glauben begangenen Unrechts in der Geschichte zu gedenken. Wie sehr sich der "Tag des Judentums" in diesen Jahren etabliert hat, zeigen die vielfältigen Veranstaltungen und Gottesdienste in Österreich. Was mit "Gedenktag" begonnen hat, wurde um einen "Lerntag" erweitert, um einen "Tag des Lernens vom Judentum". Das hat vielfältige Formen und findet an unterschiedlichen Orten statt.
Entscheidend dabei ist, nicht über das Judentum zu lernen, sondern vom Judentum und besonders mit mit Jüdinnen und Juden.
An Schulen und Jugendzentren werden jüdische Jugendliche eingeladen, um über ihre Religion mit Gleichaltrigen ins Gespräch zu kommen. Unterstützung finden solche Initiativen bei LIKRAT, dem Dialogprojekt mit Jugendlichen der Jüdischen Gemeinde.
In den Sonntagsgottesdiensten der Kirchen werden für die Homilie zu den Lesungen aus dem Alten/Ersten Testament jüdische Schriftauslegungen herangezogen, weil die Christen "viel von der jüdischen Exegese lernen" können, wie der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Josef Ratzinger, betonte.
Das Katholische Bibelwerk und die Österreichische Bibelgesellschaft laden einen international führenden Rabbiner zu einem Vortrag über jüdische Schriftauslegung ein und die Jüdische Gemeinde stellt dafür ihr Gemeindezentrum zur Verfügung. Entscheidend dabei ist, nicht über das Judentum zu lernen, sondern vom Judentum und besonders mit mit Jüdinnen und Juden.
Der Wunsch von Dechant Ferenc Simon, Diözesanbeauftragter für jüdisch-christliche Zusammenarbeit in der Erzdiözese Wien, nach einem "Sonntag des Judentums" hat eine innere Logik, wie er treffend sagt: "Wir hätten dann zwei thematische Sonntage, die wie eine Klammer die ‚Gebetswoche für die Einheit der Christen‘ rahmen würden. Den 'Sonntag des Judentums' am Beginn und den 'Sonntag des Wortes Gottes' am Ende der Gebetswoche."
2021 ist der 17. Jänner ein Sonntag. Dann wird aus dem "Tag des Judentums" ein "Sonntag des Judentums" und alle Kirchen können in ihren Sonntagsgottesdiensten dem Anliegen des "Tag des Judentums" entsprechen. Der Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit wird sie dabei unterstützen.
So würden die Kirchen auch ihrer Verantwortung im Kampf gegen Antisemitismus gerecht werden, einer Aufgabe, die erstmals im Regierungsprogramm 2020-2024 einen breiten Raum einnimmt. Zugleich wäre dies eine angemessene Antwort im Gedenken der "Wiener Gesera" und ihr blutiges Ende am 12. März 1421.
Dr. Martin Jäggle ist Präsident des Koordinierungsausschusses für jüdisch-christliche Zusammenarbeit.
Erklärung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich zur Einführung des Tags des Judentums
Der Ökumenische Rat der Kirchen in Österreich hat in seiner Vollversammlung am 21. Oktober 1999 den beiliegenden Text einstimmig angenommen. Er lädt alle christlichen Kirchen in Österreich ein, am 17. Jänner 2000 den Tag des Judentums zum ersten Mal in Österreich zu begehen. Einen Tag vor der Gebetswoche für die Einheit der Christen (18. bis 25. Jänner) mögen sich die Christen gemeinsam auf ihre jüdische Wurzel besinnen. Die jahrhundertelange Verfolgung der Juden durch Christen macht es notwendig, dass auf dem Weg der Buße und der Neubesinnung eine Haltung gegenüber den Juden heranreift, die dem Evangelium entspricht. Der Tag des Judentums ist also ein Besinnungstag der Christen. Er steht ganz in der Tradition der Zweiten Europäischen Ökumenischen Versammlung 1997 in Graz und des Christentages 1999 in Österreich.
Wien, 23. Oktober 1999
Metropolit Erzbischof Michael Staikos für den Ökumenischen Rat der Kirchen in Österreich
Univ.-Prof. Dr. Gerhard Bodendorfer für den Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Auszüge aus der Erklärung:
Das Motto für den „Tag des Judentums“ gibt der Apostel Paulus vor: „Nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich“ mahnt er im 11. Kapitel des Römerbriefs. Offensichtlich bestand schon in den ersten christlichen Gemeinden die Tendenz, sich über das Judentum erhaben zu fühlen. Später haben die Kirchen die Worte des Paulus vergessen. Anstatt ihre Wurzel, aus der sie leben und die sie trägt, zu pflegen, meinten sie, ohne sie auskommen zu können. Die theologische Verachtung des Judentums und in Folge die gesellschaftliche Abwertung seiner Gläubigen schuf über Jahrhunderte hinweg jenen Nährboden, auf dem das rassistische Gedankengut des Antisemitismus wachsen konnte. Erst seit Katastrophe der Schoa (des Holocaust) hat in allen Kirchen ein Umdenken gegenüber dem Judentum begonnen. Seither werden wir uns der Schuld, die die Kirchen und ihre Vertreter auf sich geladen haben, immer deutlicher bewusst. Wir Sind auf dem Weg, den spirituellen und theologischen Reichtum Israels als Fundament unseres eigenen Glaubens neu zu entdecken. Ein Beitrag dazu soll auch der "Tag des Judentums“ in unseren Kirchen sein, den wir in Zukunft jedes Jahr feiern wollen.
„Die Wurzel trägt dich!“ erinnert Paulus. So gesehen ist der christlich-jüdische Dialog das grundlegende Thema für unser Selbstverständnis als Christinen und Christen, er ist elementar für die Identität der Kirchen. Er ist nicht von aussen heran getragen, sondern jede Katechese redet von Juden, jede Predigt interpretiert jüdische Texte. Wer Psalmen betet, betet jüdische Gebete. Christinnen und Christen haben keinen beliebigen, sondern diesen bestimmten Wurzelgrund. Die Worte „Gott, Geist, Reich Gottes, loben, beten, Weisheit, Gerechtigkeit, Recht, Frieden“ oder „Messias“ sind konkret biblisch-jüdisch gefüllt. Gott hat es gefallen, Israel zuerst und bleibend abzusprechen. Die Worte und Namen „Abraham, Jakob, Mose, Hagar, Sarah, Miriam, Jerusalem, Zion, Halleluja, Hosanna“ lassen sich nicht auswechseln. Doch diese unverwechselbaren Identitäten hatten von Anfang an nicht allein Bedeutung nur für das eigene Volk. Stets hatte die Offenbarung Gottes an Israel einen weiten Horizont: das biblische Konzept der Schöpfung und der Vollendung der Welt ist universal auf die Völkerwelt ausherichtet.
Einladung zu Einführung eines Tages des Judentums vom 21. Oktober 1999 (Nr. K. II28`), in: Henrik, Hans Hermann / Kraus, Wolfgang (Hg.): Die Kirchen und das Judentum, Band 2: Dokumente von 1986 bis 2000, Bonifatius-Druckerei: Paderborn/Kaiser: München 2001, 311-312
9. Jänner 2025 um 18:30 Uhr
Universität Wien
1010 Wien, Universitätsring 1
Dekanatssitzungssaal KTF
Kooperation mit ÖRKÖ
Anmeldung
Die Pharisäer waren keine „Pharisäer“
Grußworte Oberrabbiner Jaron Engelmayer und Bischof Tiran Petrosyan, Vorsitzender des ÖRKÖ.
Vortrag Prof. Amy-Jill Levine: „Über Pharisäer predigen“ (online, engl. mit Übersetzung), in Kooperation mit STUV Kath. und Evang. Theologie sowie Judaistik.
Lit.: Joseph Sievers/Amy-Jill Levine/Jens Schröder (Hrsg.) (2024): Die Pharisäer. Geschichte und Bedeutung. Freiburg: Herder
Kurzbiographie (inkl. aktuelle Publikationen) von Amy-Jill Levine
Amy-Jill Levine ist eine renommierte amerikanische Theologin und Neutestamentlerin, die für ihre interdisziplinäre Arbeit im Bereich der jüdisch-christlichen Studien bekannt ist. Sie wurde am 4. Dezember 1956 in Massachusetts geboren und ist jüdischer Herkunft. Levine promovierte an der Duke University und ist Professorin für Neues Testament und Jüdische Studien an der Vanderbilt University Divinity School und im College of Arts and Sciences. In 2019 war sie die erste Jüdin, die im Pontifical Biblical Institute (Rom) über das Neue Testament unterrichtet hat.
Levine, wirft einen kritischen Blick auf die christliche Interpretation des Neuen Testaments und betont die jüdischen Wurzeln dieser Texte. Ihre Arbeit ist geprägt von dem Bestreben, Vorurteile und Fehlinterpretationen zu überwinden, die das jüdisch-christliche Verhältnis über Jahrhunderte hinweg belastet haben. In diesem Sinne brache sie zusammen mit Marc Zvi Brettler 2021 {2011} „Das Neue Testament Jüdisch Erklärt“ heraus. Außerdem setzt sie sich für die Beseitigung antisemitischer, sexistischer und homophober Theologien ein.
Hinsichtlich der Thematik das Tags des Judentums 2025 sind zwei Werke Levines zu nennen: Joseph Sievers/Amy-Jill Levine/Jens Schröder (2024): Die Pharisäer. Geschichte und Bedeutung und Joseph Sievers/Amy-Jill Levine (2021), The Pharisees: An Interdisciplinary Study.
Publikationen:
Joseph Sievers/Amy-Jill Levine/Jens Schröder (Hrsg.) (2024): Die Pharisäer. Geschichte und Bedeutung. Freiburg: Herder
The Gospel of Mark: A Beginner’s Guide to the Good News (Nashville: Abingdon, 2023).
Signs and Wonders: A Beginner’s Guide to The Miracles of Jesus (Nashville: Abingdon, 2022).
Joseph Sievers and Amy-Jill Levine (eds.), The Pharisees: An Interdisciplinary Study (Grand Rapids: Eerdmans, 2021): Italian.
Amy-Jill Levine and Marc Brettler (eds.), Jewish Annotated New Testament (JANT), Study Bible, 2d expanded and revised edition (New York: Oxford University Press, 2017); Das Neue Testament Jüdische Erklärt, Lutherübersetzing (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2021).
Amy-Jill Levine and Marc Z. Brettler, The Bible With and Without Jesus: How Jews and Christians Read the Same Stories Differently (New York: HarperOne, 2020); Portuguese, German, Japanese.
Sermon on the Mount: A Beginner’s Guide to the Kingdom of Heaven (Nashville: Abingdon Press, 2020).
Amy-Jill Levine and Ben Witherington III, The Gospel of Luke, New Cambridge Bible Commentaries (Cambridge: University Press, 2018).
Amy-Jill Levine, General Editor, New Testament, Oxford Biblical Commentary Series (OBCS), New York: Oxford University Press, 2018.
Short Stories by Jesus: The Enigmatic Parables of a Controversial Rabbi (San Francisco: HarperOne, 2014): Spanish, Italian.
The Misunderstood Jew: The Church and the Scandal of the Jewish Jesus (HarperSanFrancisco, 2006).
Mi. 17.01.2024 | 19:00 Uhr - 21:15 Uhr | Abend zum Tag des Judentums
Judentum im Film.
Film als Midrasch

Die Analyse jüdischer Lebenswelten im populären Kino ist eine noch zu entdeckende Bilderwelt. Spielfilme sind aber nicht nur reine Unterhaltung. Filme, die sich mit jüdischen Lebenswelten und jüdisch traditioneller Literatur auseinandersetzen, sind als moderner Midrasch zu verstehen. Sie sind zeitgenössische Kommentare und mischen die Elemente der jüdischen Tradition oft bunt und mehr oder weniger geschickt durcheinander. Ihre Bilderwelten prägen das öffentliche Bild des Judentums bzw. das, was man über das Judentum zu kennen glaubt. Im Vortrag Im Seminar wird gezeigt, wie jüdische Kulturgeschichte und ihre Elemente ihren Weg auf die Leinwand gefunden haben, wie jüdische Themen und Motive in Spielfilmen – von der Stummfilmzeit bis zur Gegenwart – weltweit verarbeitet wurden. Dabei können wir sehen, dass in den vorgestellten Filmen das Judentum keineswegs nur ein Beiwerk ist, sondern dass die Filme in ihrer Auseinandersetzung mit der jüdischen Kulturgeschichte auf intertextuelle Weise einen durch und durch modernen Kommentar darstellen und das Bild jüdischer Religion in der Populär-Kultur entscheidend geprägt habe – Film als Midrasch.
Referent: Univ.-Prof. Mag. Dr. Klaus Davidowicz
Professor am Institut für Judaistik in Wien, Begründer der visuellen jüdischen Kulturgeschichte an der Universität Wien
Kurzbeitrag:
Die Darstellung des Judentums in Jesus-Filmen, Dr. Marijan Orsolic
Kursbeitrag:
€ 12,—
€ 8,— für alle in Ausbildung bis 27 Jahre
Veranstalter:
Ressort Erwachsenenbildung / Team Spiritualität & Dialog, Bildungshaus St. Hippolyt, Institut Fortbildung Religion der KPH Wien/Krems, Katholischer Akademiker*innen Verband
Anmeldung
EINANDER IM BLICK
Dienstag, 14. Jänner 2025, Katholische Privatuniversität Linz
Perspektiven auf den christlich-jüdischen Dialog 60 Jahre nach Nostra aetate
Erinnern an die Verfolgten
Rundgang zu den Gedenkstelen jüdischer NS-Opfer in Linz
Zeit:
BEGINN 21. März 2025, 17:30 Uhr
ENDE 21. März 2025, 19:00 Uhr
Ort:
Treffpunkt: Stele Hessenplatz (Ecke Volksfeststraße)
4020 Linz
VERANSTALTUNGSORT
DIÖZESANHAUS, FESTSAAL
TARVISER STRASSE 30, 9020 KLAGENFURT
17. JAN.
MITTWOCH
19:00 - 21:00
Veranstalter:
Die christlichen Pfarrgemeinden Klagenfurts
Zeit zur Umkehr
Zum Tag des Judentums am 17. Jänner 2024 laden die christlichen Pfarrgemeinden Klagenfurts um 19.00 Uhr zu einer Veranstaltung ins Diözesanhaus nach Klagenfurt ein.
Vor 25 Jahren hat die evangelische Kirche in Österreich in der Erklärung „Zeit zur Umkehr“ ihr Verhältnis zum Judentum aufgearbeitet und sich zu einem Weg des Miteinanders verpflichtet.
In der katholischen Kirche hat sich seit dem 2. Vatikanischen Konzil die Sichtweise auf das Judentum grundlegend geändert. Dabei wurde christlicher Antisemitismus zurückgewiesen und ein Weg des Dialogs begonnen.
An diesem Abend geht es um diese christliche Schuldgeschichte im Umgang mit Jüdinnen und Juden und darum, welche Bedeutung heute das Judentum für Christinnen und Christen hat.
Statements dazu halten die evangelische Pfarrerin Dr.in Margit Leuthold und katholische Pfarrer Dr. Richard Pirker.
Moderation:
Dr. Karl-Heinz Kronawetter
Am Podium:
Dr.in Margit Leuthold, Vizepräsidentin des Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit und Pfarrerin der evangelischen Pfarrgemeinde A.B. in Lienz
Dr. Richard Pirker, Geistlicher Assistent der Katholischen Aktion Kärnten und Pfarrer der katholischen Pfarrgemeinde Villach-St. Jakob
Musik:
„Duo Miriam Hauser“
Jesus aus jüdischer Sicht
16. Jänner 2025, 19.30 Uhr;
Haus der Begegnung, Innsbruck.
Rabbi Dr. Jehoschua Ahrens
Ökologie in 5 Bänden - Umwelt in der Torah
Vortrag und Gespräch zum "Tag des Judentums" mit Dr. Willy Weisz
17. JAN.
MITTWOCH
19:30 - 20:30
Ein Plädoyer für die gerne vergessene Wurzel des Christentums
Der 17. Jänner wird als Tag des Judentums begangen. Er soll uns Christen ins Bewusstsein rufen, dass die Jüdinnen und Juden unsere älteren Geschwister im Glauben sind. Den gesamten ersten Teil der Bibel, das Alte Testament, haben wir nämlich von ihnen übernommen. Leider meinen etliche Christen auch heute noch, ohne dieses auskommen zu können. Zumindest aber schätzen viele das Alte Testament gering und meinen, es sei durch das Neue Testament überholt. Der Vortrag will aufzeigen, was sich Christen vorenthalten, wenn sie so denken. Wer Christus kennen und verstehen will, kommt ohne das Alte Testament, die Bibel Jesu, nicht aus.
Freiwillige Spende erbeten!
Anmeldung
Studiennachmittag zum Tag des Judentums
Donnerstag, 16. Jänner 2025
Zeit: 15:00 – 18:00 Uhr
Ort: HS 101 (Kath.-Theol. Fakultät, Universitätsplatz 1, Salzburg)
Programm:
Ein Blick ins Nachbarland Ungarn: Jüdisches Leben, interreligiöser Dialog und aktuelle Religionspolitik
Thema unseres Studiennachmittags sind aktuelle Fragen des jüdischen Lebens und des interreligiösen Dialogs im Nachbarland Ungarn. Zum einen geht es dabei um die größte jüdische Gemeinschaft Ostmitteleuropas mit ihren vielfältigen religiösen Traditionen, zum anderen um Entwicklungen im Verhältnis von Staat und Kirchenpolitik, die von vielen kritisch wahrgenommen werden – und die auch für die jüdischen Gemeinden nicht ohne Auswirkung bleiben.
IMPULSVORTRÄGE
Religionen und Religionspolitik im Horizont des Rechtspopulismus in Ungarn heute Mag. Dr. theol. Rita Perintfalvi, Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie der Universität Graz
Jüdisches Leben in Ungarn: Historisches Erbe und aktuelle Herausforderungen Prof. Dr. Karl Vajda, ehem. Rektor der Jüdischen Universität zu Budapest
DISKUSSION
Moderation: Dr. Mihály Riszovannij, Zentrum für Jüdische Kulturgeschichte
Tag des Judentums 2025 – Dialog im Zeichen der Geschichte des Judentums
Datum: Freitag, 17. Jänner 2025, 17:00 Uhr
Ort: Private Pädagogische Hochschule Burgenland, SR N1.2.05 (eh. SR 10), 2. Stock
Der Tag des Judentums steht 2025 im Zeichen der Geschichte des Judentums. Drei Kurzvorträge nehmen Spuren der Geschichte des Judentums auf. Zunächst gibt Ursula K. Mindler-Steiner einen knappen Überblick über das jüdische Leben in Oberwart/Felsőőr. Dann fokussiert Martin Krenn auf die Biographie des Direktors des Burgenländischen Landesmuseums Alphons Barb. Ergänzt wird die historische Perspektive mit einem Beitrag von Lukas Pallitsch zur Bedeutung des christlich-jüdischen Dialogs 60 Jahre nach Nostra aetate. Die Vorträge werden musikalisch von Andrea Schwab gerahmt, die sich auf die Werke von Komponistinnen spezialisiert hat, die während der Zeit des Nationalsozialismus verboten und vertrieben wurden.
Eine Veranstaltung des christlich-jüdischen Koordinierungsausschusses in Kooperation mit der PPH Burgenland
Konzeption: Dr. Lukas Pallitsch PhD, DDr. Martin Krenn
Musik: Dr.in Andrea Schwab, gemeinsam mit Mag. Ernst Ramsauer, Mag.a Eva Kopf-Ornulad
Moderation: Dr. Marin A. Hainz
Erinnerung an die Zukunft: Zum christlich-jüdischen Dialog 60 Jahre nach Nostra aetate
Im Judentum und im Christentum kommt der Erinnerung eine wichtige Funktion zu. Schließlich handelt es sich bei diesen Religionen um Erinnerungsgemeinschaften. Erinnern ist nicht etwa nebensächlich, sondern Urzelle religiöser Lebensäußerung. Mit der Erklärung Nostra aetate änderte die katholische Kirche vor 60 Jahren ihre Haltung zum Judentum grundlegend. Seither ist der katholischen Kirche auch die Erinnerung an alle Manifestationen des Antijudaismus ins Stammbuch geschrieben.
Prof. Dr. Lukas Pallitsch PhD, Theologe und Literaturwissenschaftler, ist Fachinspektor und unterrichtet Deutsch an der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Forschungsschwerpunkte u.a. zum christlich-jüdischen Dialog, zum Verhältnis von Literatur und Religion und zur deutsch-jüdischen Literatur.
Zur jüdischen Geschichte von Oberwart/Felsőőr
Die jüdische Gemeinde von Oberwart/Felsőőr war die jüngste Israelitische Kultusgemeinde des Burgenlandes. 1930 gegründet, wurde sie bereits 1938 wieder gewaltsam aufgelöst. Der Vortrag gibt einen Überblick über jüdisches Leben in Oberwart/Felsőőr im 19. und 20. Jahrhundert.
Assoz. Prof.in Priv.-Doz. Mag.a Dr.in Ursula K. Mindler-Steiner ist Historikerin an der Universität Graz und der Andrássy Universität Budapest. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen u.a. jüdische und Romani Geschichte, die Geschichte des deutschwestungarischen/burgenländischen Gebietes, NS-Geschichte und Biographie, Identität, Erinnerung und Gedächtnis. Sie legte zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, u.a. zur jüdischen Gemeinde von Oberwart/Felsőőr, vor.
Die Vertreibung von Alphons Barb, Direktor des Burgenländischen Landesmuseums
Ab 1926 war der gebürtige Wiener Alphons Barb (1901–1979) mit dem Auf- und Ausbau des Burgenländischen Landesmuseums in Eisenstadt betraut, dessen Leitung er bis zu seiner aufgrund seines jüdischen Bekenntnisses erfolgten Entlassung durch die Nationalsozialisten im März 1938 innehatte. Der Vortrag beleuchtet diese Zäsur in der Biographie Barbs sowie seinen weiteren Lebensweg, der ihn ab 1939 ins englische Exil führte.
Prof. DDr. Martin Krenn, Historiker und Archivar, unterrichtet Geschichte an der Privaten Pädagogischen Hochschule Burgenland. Forschungsschwerpunkte u.a. Historische Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes ab der Frühen Neuzeit, österreichische und burgenländische Stadtgeschichte, Wissenschaftsgeschichte.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Beste Grüße | Lip pozdrav | Üdvözlettel | Schukar di | Best regards
Mag. Dr. Sabine Weisz
Rektorin
HS-Prof. Mag. Dr. Herbert Gabriel
Vizerektor für Forschung
und Hochschulentwicklung
HS-Prof. Mag. Eva Gröstenberger PhD
Vizerektorin für Lehre,
Mehrsprachigkeit und Internationalisierung
Tag des Gedenkens -
27. Tag des Judentums
15. Jänner 2026 19.00 Uhr
Festsaal der Bezirksvorstehung Alsergrund, Wien 9., Währingerstraße 43
Vereinssynagoge Müllergasse (u.a.)
WIEN
Synagoge Josefstadt Neudeggergasse
13. Jänner 2025 um 19:00 Uhr
Bezirksmuseum Josefstadt
Schmidgasse 18, 1080 Wien
Anmeldung
Grußworte BV Martin Fabisch und Gen.-Sekr. IKG Wien Benjamin Naegele, 25 Jahre Gedenkarbeit „Verlorene Nachbarschaft“, „Gedanken zum Gedenken“ Pfarrerin Julia Schnizlein, Gebete, musik. Gestaltung Mazeltov Kapelle.
18.15 Uhr Führung mit Dr. Karin Hanta durch die Ausstellung „Ich wollte Wien liebhaben, habe mich aber nicht getraut“ Lore Segal 1928 – 2024
Kratz, Käthe / Karin Schön / Hubert Gaisbauer / Hans Litsauer, Verlorene Nachbarschaft. Die Wiener Synagoge in der Neudeggergasse. Ein Mikrokosmos und seine Geschichte, Wien: 1999
Anschluss eine kleine koschere Agape
RADIO
INNSBRUCK
Wichtige Dokumente und Literatur
Dialog - DuSiach zum Tag des Judentums 2021
Ein Gedenktag für Christinnen und Christen
Der Gottesdienstvorschlag für den Tag des Judentums wurde von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des „Koordinierungsausschusses für christlich-jüdische Zusammenarbeit“ gestaltet und von der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich im Herbst 1999 verabschiedet. Seit seiner ersten Fassung haben wir den Text in Details immer wieder weiterentwickelt und umgearbeitet. Die Lieder und die ausgewählten Lesungen wechselten, die Gebete blieben im Wesentlichen gleich, um eine jährliche Gewohnheit und Tradition wachsen zu lassen.
Als Erweiterung zu diesem Gottesdienstentwurf hat 2017 unser Grazer Lokalkomitee eine Handreichung für Gemeinden herausgegeben: Feiermodelle, Texte und Materialien geben sowohl Orientierung als auch Gestaltungsspielraum.
Das Gottesdienstheft für den Wiener Ökumenischen Gottesdienst zum Tag des Judentums können Sie gratis über uns beziehen; schicken Sie uns einfach eine Mail.
Die umfassende Handreichung erhalten Sie für eine Spende von 3€ über das Grazer Lokalkomitee.
WIEN
17. Jänner 2026 18.00 Uhr
Armenisch-apostolische Kirche Wien 3., Kolonitzgasse 11 (im Hof)
Ökumenischer Gottesdienst des ÖRKÖ, Gedanken zum Tag des Judentums 2026
„Thema: Lasst uns Gott lernen Hosea 6,3-6
Predigt Dechant und Pfarrer Ferenc Simon
GRAZ
Ökumenischer Gottesdienst zum Tag des Judentums
„Liebe deinen Fremden!“
Do., 16. Jänner 2025, 19.00 Uhr
Evangelische Heilandskirche Graz (Kaiser-Josef-Platz 9, 8010 Graz)
Predigt: Apostel Matthias Pfützner (Neuapostolische Kirche Österreich)
Vorarlberg
Sonntag, 19. Jänner 2025
Wer eine Reise tut, der kann etwas erzählen
Der jährlich begangene Tag des Judentums am 17. Januar ist ein guter Anlass das jüdische Leben und den jüdischen Glauben in den Blick zu nehmen. Wir laden zu einer Exkursionsfahrt nach München ein. Dort wollen wir im Rahmen einer Führung die Ohel-Jakob-Synagoge besichtigen. Da Essen entsprechend einem alten Sprichwort Leib und Seele zusammenhält, wollen wir im Anschluss in einem jüdischen Restaurant gemeinsam zu Abend essen und den Austausch über das Gehörte pflegen.
Die konkreten Reisedaten:
Für die gemeinsame Busfahrt mit Herburger Reisen nach München gibt es unterschiedliche Zustiegsmöglichkeiten:
11:00 Abfahrt Bludenz Bahnhof
11:25 Abfahrt Feldkirch Busbahnhof
12.00 Abfahrt Bregenz Bahnhof
15.00 Ankunft und Check-in bei der Ohel-Jakob-Synagoge
15.30 Beginn der Führung
17.30 Gemeinsames Abendessen im Restaurant
19.30 Geplante Abreise in München
23:30 Geplante Ankunft in Bludenz mit Ausstiegsmöglichkeiten in Bregenz und Feldkirch
Auf Grund von Sicherheitsbestimmungen ist eine verbindliche Anmeldung bis 1. Jänner 2025 an katharina.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at notwendig.
Keine Teilnehmergebühr, aber Selbstbezahlung von Essen und Getränken.
Wir freuen uns, über Ihre Teilnahme
Die altkatholische, evangelische, katholische und die serbisch-orthodoxe Kirchen Vorarlbergs
Gottesdienst-Modelle
Gottesdienst des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich
Preis dem „Ich-bin-da“ von Christian Rutishauser SJ Wortliturgie zum „Tag des Judentums“
biblische Lesungen
Biblische Lesungen der christlichen Kirchen und jüdische Stimmen zu den Sonntagslesungen
Grundsätze für die Predigt
Katholische Kirche
1 Sam 3, 3b-10.19
Ps 40 (39), 2 u. 4ab.7-8.9-10 (R: vgl. 8a.9a)
1 Kor 6, 13c-15a.17-20
Joh 1, 35-42
Evangelische Kirche
I Röm 12,9–16
II Jer 14, 1(2)3–4(5–6)7–9
III Joh 2,1–11
IV 1. Kor 2,1–10
V 2. Mose 33,18–23
VI Hebr 12,12–18(19–21)22–25a
Orthodoxe Kirche
Vesper/Abendgebet: Weish 3,1-9; Weish 5,15-23 & 6,1-3; Weish 4,7-15
Morgengebet: Mt 11,27-30
Liturgie: Hebr 13,17-21; Lk 6,17-23
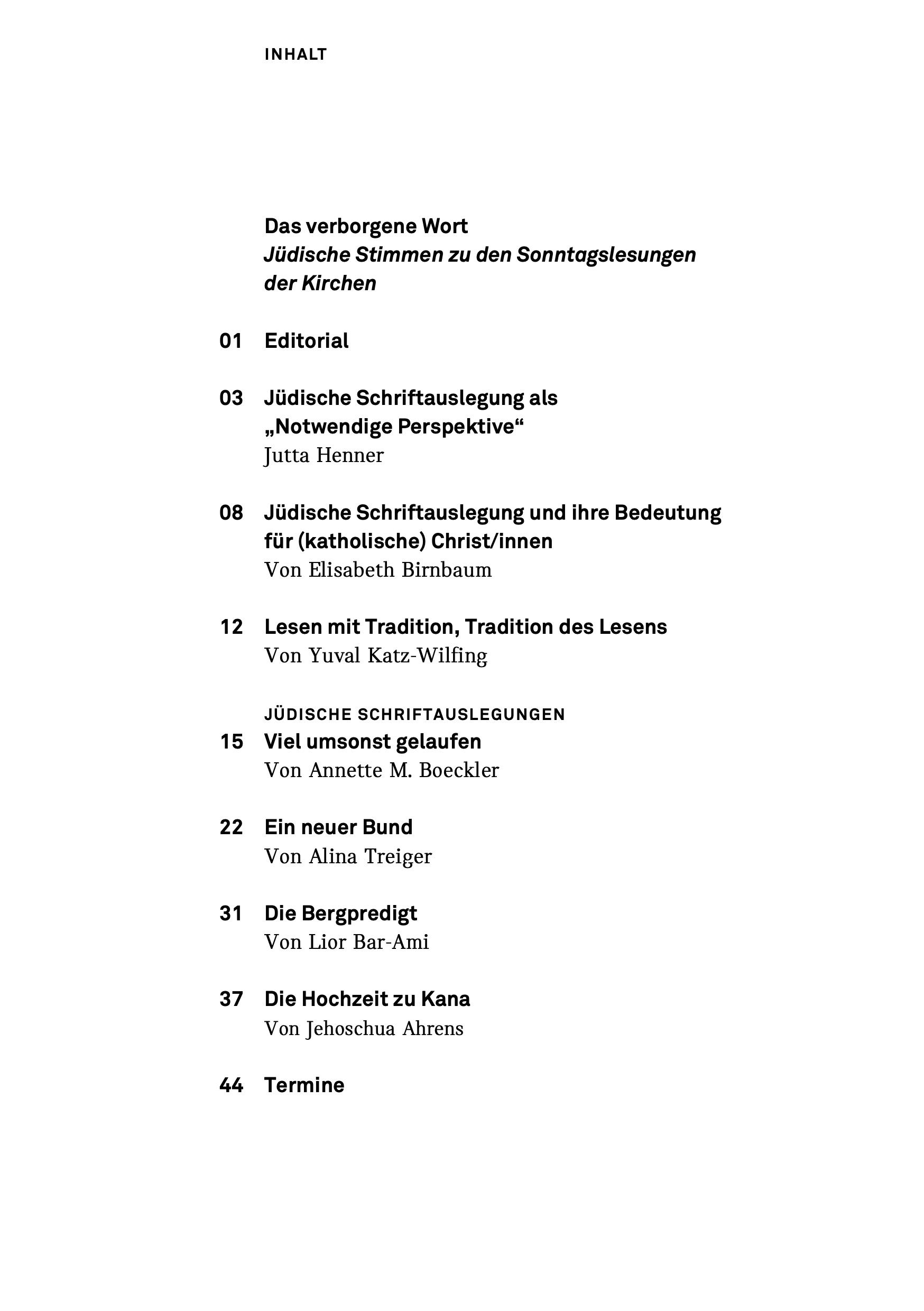
Wissenschaftliche Artikel - Relevante Nachrichten - Dokumentation und Information
„DuSiach“ bedeutet „Zwiegespräch“ und ist die hebräische Entsprechung des Wortes „Dialog“. Die Zeitschrift
wurde von Schwester Hedwig Wahle ins Leben gerufen. Sie wird seit über 20 Jahren vierteljährlich herausgegeben und beinhaltet neben relevanten, informativen und interessanten Fachartikeln oft internationaler Autor_innen auch Berichte und Dokumente zu wichtigen Ereignissen, die den christlich-jüdischen Dialog betreffen. Zentral ist auch der praktische Bezug, der durch Draschot und Predigten sowie Termin- und Buchempfehlungen hergestellt wird.
Zahlreiche namhafte Autor_innen wie der Schriftsteller Doron Rabinovici, die Philosophin Isolde Charim oder der Präsident des International Council of Christians and Jews, Philipp Cunningham, haben Beiträge im Dialog-DuSiach veröffentlicht.
Abonnement in Österreich ohne Mitgliedschaft: 21€/Jahr
Abonnement im Ausland ohne Mitgliedschaft: 26€/Jahr
Abonnement mit Mitgliedschaft: 35€/Jahr
Abonnement mit Fördermitgliedschaft: 120€/Jahr
Einzelheft: 6€
Bitte schicken Sie Ihren Namen und Ihre Adresse und zahlen Sie Ihren Abonnementbeitrag ein.
Schelhammer & Schattera
BIC: BSSWATWW
IBAN: AT19 1919 0000 0025 0613
GL 619,1 Alles was Odem hat
GL 453/EGB 171 Bewahre uns Gott, behüte uns, Gott
GL 398/EGB 181.7 Jubilate Deo
GL 386/EGB 181.6 Laudete omnes gentes
GL 437/EGB 574 Meine engen Grenzen
GL 551 Nun singt ein neues Lied dem Herren
GL 458/EGB 636 Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt
GL 481/EGB 262 Sonne der Gerechtigkeit
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, / meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. / Kommet zuhauf, / Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset den Lobgesang hören!
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der dich erhält, wie es dir selber gefällt; / hast du nicht dieses verspüret?
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,/ der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet./ In wie viel Not/ hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet!
Psalmen
Psalm 1 Selig der Mensch
Psalm 15 Wer wohnt auf Deinem heiligen Berge?
Psalm 23 Der HERR ist mein Hirte
Psalm 84 Selig ein Mensch, dessen Stärke in dir gründet
Psalm 100 Alle Länder der kommen zum Tempel des HERRN
Psalm 111 Anfang der Weisheit ist Ehrfurcht vor dem HERRN
Psalm 122 Verlangt nach Frieden für Jerusalem!
Schuldbekenntnis
Alle: Barmherziger Gott, wir bekennen vor dir, dass wir uns als Kirchen schuldig gemacht haben an deinem Volk Israel. Wir bekennen, dass Christinnen und Christen auch heute nicht wachsam genug sind, wenn Menschen wegen ihrer jüdischen Herkunft oder ihres Glaubens angefeindet und verachtet werden. Wir haben uns gerne die Gaben deines Volkes angeeignet – das Alte Testament, deinen Bund, den Gottesdienst und die Verheißungen. Wir bekennen, dass wir mit ihm selbst keine Gemeinschaft haben wollten. Mit tiefem Schmerz sehen wir die lange Spur an Blut und Tränen, an namenlosem Leid und Tod durch die Jahrhunderte, die Christinnen und Christen verursacht haben. Wir bitten dich um dein Erbarmen und deine Vergebung. Auch heute noch sind viele deiner Christinnen und Christen mit blind dafür, was du an deinem Volk und damit an allen wirken willst. Öffne uns die Augen für das Geheimnis deiner Wege. Wir bitten dich um dein Erbarmen und deine Vergebung.
Gebet
Gott unser Vater, du hast die Welt erschaffen, du hast gegenüber Noa für immer deine Treue zur Schöpfung bekräftigt. Du hast dein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit
und hast ihm Erlösung geschenkt. Du hast Israel erwählt, ihm deine Gebote gegeben und mit ihm einen Bund geschlossen. Dieser Bund hat ewig Bestand. Du bist der Gott Abrahams und Saras, der Gott Isaaks und Rebekkas, Jakobs, Rahel und Leas, der Gott Moses’, Aarons und Mirjams, der Gott Davids und Salomos, der Gott von Ester, Judit und Rut, der Gott Jesu und seiner Mutter Maria. Wir danken dir, dass dein Volk Israel und auch wir heute an deinen Heilstaten teilhaben dürfen, die du an den Vätern und Müttern des Glaubens und an ganz Israel für alle Völker offenbart hast. Denn von Zion kommt die Thora, deine Weisung und dein Wort von Jerusalem, unter deinem Rechtsspruch stehen alle Völker.
Führe und begleite uns auf diesem Weg und gib uns Klarheit,
mit Israel das Licht deiner Weisung zu erkennen und deinen heiligen Willen zu tun. Alle: Amen.
Fürbitten
Gott, unser Vater, du hast Juden und Christen dazu berufen, von deinem Namen Zeugnis zu geben. Höre uns, wenn wir jetzt unsere Bitten vor dir aussprechen:
- Für die jüdischen Gemeinden in unserem Land und in dieser Stadt: Herr, gib ihnen Bestand und Wachstum in Frieden.
- Für Juden und Christen: Bewahre unsere Wege zueinander in Dankbarkeit für deine Treue zu deinem Bund.
- Für Menschen verschiedener Völker und Religionen, die in diesem Bezirk leben, beten und arbeiten: Mache sie bereit, trotz kultureller und religiöser Unterschiede, einander anzunehmen und füreinander einzustehen.
- Für die Kirchen: Dass sie die jüdische Wurzel, aus der sie wachsen und genährt werden, erkennen und davon Zeugnis geben.
- Für die Menschen in Israel und Palästina: Wir hoffen und beten, dass Juden, Muslime und Christen Wege finden, damit sie in Gerechtigkeit und Frieden miteinander leben können.
- Für alle Völker: Gott, erfülle deine Verheißung, dass alle Enden der Erde dein Heil schauen werden.
- Für uns selbst: Herr, verwandle unser Herz und mache uns frei von Angst und Gleichgültigkeit. Hilf uns, dem Unrecht in jeder Gestalt entgegen zu treten.
Weitere Fürbitten hier…
Segen: Num 6,24-26
Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Alle: Amen
Auszug aus dem Dokument: Hinweise für eine richtige Darstellung von Juden und Judentum in der Predigt und in der Katechese der katholischen Kirche (1985)
II. Beziehungen zwischen Altem und Neuem Testament
(Im Text wird der Ausdruck „Altes Testament“ weiterhin verwendet, weil er traditionell ist (vgl. schon 2 Kor 3,14), aber auch, weil „Alt“ weder „verjährt“ noch „überholt“ bedeutet. Auf jeden Fall ist es der bleibende Wert des Alten Testamentes als Quelle der christlichen Offenbarung, der hier unterstrichen werden soll (vgl. Dei Verbum, 3).)
1. Es geht darum, die Einheit der biblischen Offenbarung (Altes Testament und Neues Testament) und die Absicht Gottes darzustellen, bevor man von jedem einzelnen dieser historischen Ereignisse spricht, um zu unterstreichen, daß jedes davon seinen Sinn nur bekommt, wenn es innerhalb der gesamten Geschichte, von der Schöpfung bis zur Vollendung, betrachtet wird. Diese Geschichte geht das ganze Menschengeschlecht und besonders die Gläubigen an. Auf diese Weise tritt der endgültige Sinn der Erwählung Israels erst im Lichte der eschatologischen Vollerfüllung zutage (Röm 9–11), und so wird die Erwählung in Jesus Christus im Hinblick auf die Verkündigung und die Verheißung noch besser verstanden (vgl. Hebr 4,1–11).
2. Es handelt sich um einzelne Ereignisse, die eine einzelne Nation betreffen, die aber in der Schau Gottes, der seine Absicht enthüllt, dazu bestimmt sind, eine universale und exemplarische Bedeutung zu erhalten. Es geht außerdem darum, die Ereignisse des Alten Testamentes nicht als Ereignisse darzustellen, die nur die Juden betreffen; sie betreffen vielmehr auch uns persönlich. Abraham ist wirklich der Vater unseres Glaubens (vgl. Röm 4,11 f.; Römischer Kanon: patriarchae nostri Abrahae). Es heißt auch (1 Kor 10,1): „Unsere Väter sind alle unter der Wolke gewesen, sie alle sind durchs Meer gezogen.“ Die Erzväter, die Propheten und anderen Persönlichkeiten des Alten Testaments wurden und werden immerdar in der liturgischen Tradition der Ostkirche wie auch der lateinischen Kirche als Heilige verehrt.
3. Aus der Einheit des göttlichen Planes ergibt sich das Problem der Beziehungen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Schon zur Zeit der Apostel (vgl. 1 Kor 10,11; Hebr 10,1) und dann beständig in der Tradition hat die Kirche dieses Problem vor allem mit Hilfe der Typologie gelöst; damit wird die grundlegende Bedeutung unterstrichen, welche das Alte Testament in christlicher Sicht haben muß. Allerdings erweckt die Typologie bei vielen Unbehagen; das ist vielleicht ein Zeichen dafür, daß das Problem nicht gelöst ist.
4. Man wird also bei der Anwendung der Typologie, deren Lehre und Handhabung wir von der Liturgie und den Kirchenvätern übernommen haben, wachsam darauf achten, jeden Übergang vom Alten zum Neuen Testament zu vermeiden, der nur als Bruch angesehen werden kann. In der Spontaneität des Geistes, der sie beseelt, hat die Kirche die Einstellung Markions (Ein Gnostiker des 2. Jahrhunderts, der das Alte Testament und einen Teil des Neuen als Werk eines bösen Gottes (eines Demiurgen) verwarf. Die Kirche hat auf diese Häresie kräftig reagiert (vgl. Irenäus).) energisch verurteilt und sich seinem Dualismus stets entgegengestellt.
5. Es ist auch wichtig zu unterstreichen, daß die typologische Interpretation darin besteht, das Alte Testament als Vorbereitung und in gewisser Hinsicht als Skizze und Voranzeige des Neuen zu lesen (vgl. z. B. Hebr 5,5–10 usw.). Christus ist nunmehr der Bezugspunkt und Schlüssel der Schriften: „Der Fels war Christus“ (1 Kor 10,4).
6. Es ist also wahr und muß auch unterstrichen werden, daß die Kirche und die Christen das Alte Testament im Lichte des Ereignisses von Tod und Auferstehung Christi lesen und daß es in dieser Hinsicht eine christliche Art, das Alte Testament zu lesen, gibt, die nicht notwendigerweise mit der jüdischen zusammenfällt. Christliche Identität und jüdische Identität müssen deshalb in ihrer je eigenen Art der Bibellektüre sorgfältig unterschieden werden. Dies verringert jedoch in keiner Weise den Wert des Alten Testaments in der Kirche und hindert die Christen nicht daran, ihrerseits die Traditionen der jüdischen Lektüre differenziert und mit Gewinn aufzunehmen.
7. Die typologische Lektüre zeigt erst recht die unergründlichen Schätze des Alten Testaments, seinen unerschöpflichen Inhalt und das Geheimnis, dessen es voll ist. Diese Leseweise darf nicht vergessen lassen, daß das Alte Testament seinen Eigenwert als Offenbarung behält, die das Neue Testament oft nur wieder aufnimmt (vgl. Mk 12,29–31). Übrigens will das Neue Testament selber auch im Lichte des Alten gelesen werden. Auf dieses nimmt die ursprüngliche christliche Katechese ständig Bezug (vgl. z. B. 1 Kor 5,6–8; 10,1–11).
8. Die Typologie bedeutet ferner die Projektion auf die Vollendung des göttlichen Plans, wenn „Gott alles in allem ist“ (1 Kor 15,28). Das gilt auch für die Kirche, die zwar in Christus schon verwirklicht ist, aber nichtsdestoweniger ihre endgültige Vervollkommnung als Leib Christi erwartet. Die Tatsache, daß der Leib Christi immer noch seiner vollkommenen Gestalt zustrebt (vgl. Eph 4,12 f.), nimmt dem Christsein nichts von seinem Wert. So verlieren auch die Berufung der Erzväter und der Auszug aus Ägypten ihre Bedeutung und ihren Eigenwert im Plan Gottes nicht dadurch, daß sie gleichzeitig auch Zwischenetappen sind (vgl. Nostra Aetate, 4).
9. Der Exodus beispielsweise steht für eine Erfahrung von Heil und Befreiung, die nicht in sich selbst beendet ist, sondern außer ihrem Eigenwert die Fähigkeit zu späterer Entfaltung in sich trägt. Heil und Befreiung sind in Christus bereits vollendet und verwirklichen sich schrittweise durch die Sakramente in der Kirche. Auf diese Weise bereitet sich die Erfüllung des göttlichen Planes vor, die ihre endgültige Vollendung mit der Wiederkunft Jesu als Messias, worum wir täglich beten, findet. Das Reich Gottes, um dessen Herankunft wir ebenfalls täglich beten, wird endlich errichtet sein. Dann werden Heil und Befreiung die Erwählten und die gesamte Schöpfung in Christus verwandelt haben (vgl. Röm 8,19–23).
10. Wenn man die eschatologische Dimension des Christentums unterstreicht, wird man sich darüber hinaus dessen noch klarer bewußt, daß wenn man die Zukunft betrachtet – das Gottesvolk des Alten und des Neuen Bundes analogen Zielen zustrebt: nämlich der Ankunft oder der Wiederkunft des Messias – auch wenn die Blick- und Ausgangspunkte verschieden sind. Man legt sich dann auch klarer Rechenschaft darüber ab, daß die Person des Messias, an der das Volk Gottes sich spaltet, auch der Punkt ist, in dem es zusammentrifft (vgl. Sussidi per l’ecumenismo della Diocesi di Roma, 1982, 140). So kann man sagen, daß Juden und Christen einander in einer vergleichbaren Hoffnung begegnen, die sich auf dieselbe Verheißung an Abraham gründet (vgl. Gen 12,1–3; Hebr 6,13–18).
11. Aufmerksam horchend auf denselben Gott, der gesprochen hat, hangend am selben Wort, haben wir ein gleiches Gedächtnis und eine gemeinsame Hoffnung auf Ihn, der der Herr der Geschichte ist, zu bezeugen. So müßten wir unsere Verantwortung dafür wahrnehmen, die Welt auf die Ankunft des Messias vorzubereiten, indem wir miteinander für soziale Gerechtigkeit und für Respektierung der Rechte der menschlichen Person und der Nationen zur gesellschaftlichen und internationalen Versöhnung wirken. Dazu drängt uns, Juden und Christen, das Gebot der Nächstenliebe, eine gemeinsame Hoffnung auf das Reich Gottes und das große Erbe der Propheten. Wenn sie von der Katechese frühzeitig genug vermittelt wird, könnte eine solche Auffassung die jungen Christen konkret dazu erziehen, mit den Juden zusammenzuarbeiten und so über den bloßen Dialog hinauszugelangen (vgl. Richtlinien, IV.).
III. Jüdische Wurzeln des Christentums
12. Jesus war Jude und ist es immer geblieben; seinen Dienst hat er freiwillig auf „die verlorenen Schafe des Hauses Israel“ (Mt 15,24) beschränkt. Jesus war voll und ganz ein Mensch seiner Zeit und seines jüdisch-palästinischen Milieus des 1. Jahrhunderts, dessen Ängste und Hoffnungen er teilte. Damit wird die Wirklichkeit der Menschwerdung wie auch der eigentliche Sinn der Heilsgeschichte nur noch unterstrichen, wie er uns in der Bibel offenbart worden ist (vgl. Röm 1,3 f.; Gal 4,4 f.).
13. Das Verhältnis Jesu zum biblischen Gesetz und seinen mehr oder weniger traditionellen Interpretationen ist zweifelsohne komplex; er hat große Freiheit diesem gegenüber an den Tag gelegt (vgl. die „Antithesen“ der Bergpredigt Mt 5,21–48 – wobei die exegetischen Schwierigkeiten zu berücksichtigen sind –, die Einstellung Jesu zu strenger Beobachtung der Sabbatgesetze Mk 3,1–6 usw.).
Es gibt jedoch keinen Zweifel daran, daß er sich dem Gesetz unterwerfen will (vgl. Gal 4,4), daß er beschnitten und im Tempel gezeigt worden ist, wie jeder andere Jude seiner Zeit auch (vgl. Lk 2,21.22–24), und daß er zur Beobachtung des Gesetzes erzogen worden ist. Er predigte den Respekt vor dem Gesetz (vgl. Mt 5,17–20) und forderte dazu auf, demselben zu gehorchen (vgl. Mt 8,4). Der Ablauf seines Lebens war unterteilt durch die Wallfahrten an den Festzeiten, und zwar seit seiner Kindheit (vgl. Lk 2,41–50; Joh 2,13; 7,10 usw.). Man hat oft die Bedeutung des jüdischen Festzyklus im Johannes-Evangelium beachtet (vgl. 2,13; 5,1; 7,2.10.37; 10,22; 12,1; 13,1; 18,28; 19,42 usw.).
14. Es muß auch bemerkt werden, daß Jesus oft in den Synagogen (vgl. Mt 4,23; 9,35; Lk 4,15–18; Joh 18,20 usw.) und im Tempel, den er häufig besuchte (vgl. Joh 18,20 usw.), gelehrt hat. Das taten auch seine Jünger, sogar nach der Auferstehung (vgl. z. B. Apg 2,46; 3,1; 21,26 usw.). Er hat die Verkündigung seiner Messianität in den Rahmen des Synagogen-Gottesdienstes einordnen wollen (vgl. Lk 4,16–21). Vor allem aber hat er die höchste Tat der Selbsthingabe im Rahmen der häuslichen Pessachliturgie oder zumindest des Pessachfestes vollbringen wollen (vgl. Mk 14,1.12 par.; Joh 18,28). Dies erlaubt, den Gedächtnischarakter der Eucharistie besser zu verstehen.
15. So ist der Sohn Gottes in einem Volk und einer menschlichen Familie Mensch geworden (vgl. Gal 4,4; Röm 9,5). Das verringert keineswegs die Tatsache, daß er für alle Menschen geboren worden (um seine Wiege stehen die jüdischen Hirten und die heidnischen Magier: Lk 2,8–20; Mt 2,1–12) und für alle gestorben ist (am Fuß des Kreuzes stehen ebenfalls die Juden, unter ihnen Maria und Johannes: Joh 19,25–27, und die Heiden, wie der Hauptmann: Mk 15,39 par.). Er hat so die zwei Völker in seinem Fleisch zu einem gemacht (vgl. Eph 2,14–17). Man kann also die Tatsache erklären, daß es in Palästina und anderwärts mit der „Kirche aus den Völkern“ eine „Kirche aus der Beschneidung“ gegeben hat, von der beispielsweise Eusebius spricht (Historia Ecclesiastica IV, 5).
16. Seine Beziehungen zu den Pharisäern waren nicht völlig und nicht immer polemischer Art. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür:
– Es sind die Pharisäer, die Jesus vor der ihm drohenden Gefahr warnen (Lk 13,31);
– Pharisäer werden gelobt wie der „Schriftgelehrte“ (Mk 12,34);
– Jesus ißt mit Pharisäern (Lk 7,36; 14,1).
17. Jesus teilt mit der Mehrheit der damaligen palästinischen Juden pharisäische Glaubenslehren: Die leibliche Auferstehung; die Frömmigkeitsformen wie Wohltätigkeit, Gebet, Fasten (vgl. Mt 6,1–18) und die liturgische Gewohnheit, sich an Gott als Vater zu wenden; den Vorrang des Gebots der Gottes- und der Nächstenliebe (vgl. Mk 12,28–34). Dasselbe trifft auch für Paulus zu (vgl. Apg 23,8), der seine Zugehörigkeit zu den Pharisäern immer als Ehrentitel betrachtet hat (vgl. Apg 23,6; 26,5; Phil 3,5).
18. Auch Paulus (wie übrigens Jesus selber) hat Methoden der Schriftlesung, ihrer Interpretation und Weitergabe an die Schüler verwendet, die den Pharisäern ihrer Zeit gemeinsam waren. Das trifft auch zu für die Verwendung der Gleichnisse im Wirken Jesu, wie auch für Jesu und Paulus’ Methode, eine Schlußfolgerung mit einem Schriftzitat zu untermauern.
19. Es muß auch festgehalten werden, daß die Pharisäer in den Passionsberichten nicht erwähnt werden. Gamaliel (vgl. Apg 5,34–39) macht sich in einer Sitzung des Synhedrions zum Anwalt der Apostel. Eine ausschließlich negative Darstellung der Pharisäer läuft Gefahr, unrichtig und ungerecht zu sein (vgl. Richtlinien, Fußnote 1, vgl. AAS, a.a.O., 76). Wenn es in den Evangelien und an anderen Stellen des Neuen Testaments allerhand abschätzige Hinweise auf die Pharisäer gibt, muß man sie vor dem Hintergrund einer komplexen und vielgestaltigen Bewegung sehen. Kritik an verschiedenen Typen von Pharisäern fehlen übrigens in den rabbinischen Quellen nicht (vgl. Babylonischer Talmud, Traktat Sotah 22 b usw.). Das „Pharisäertum“ im negativen Sinn kann in jeder Religion seinen Schaden anrichten. Man kann auch die Tatsache unterstreichen, daß Jesus den Pharisäern gegenüber gerade deshalb streng ist, weil er ihnen näher steht als den anderen Gruppen im zeitgenössischen Judentum (s. o. Nr. 17).
20. All dies sollte Paulus’ Feststellung (Röm 11,16 ff.) über die „Wurzel“ und die „Zweige“ besser verstehen helfen. Kirche und Christentum, neu wie sie sind, finden ihren Ursprung im jüdischen Milieu des 1. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung und – noch tiefer – im „Geheimnis Gottes“ (Nostra Aetate, 4), das in den Erzvätern, Mose und den Propheten (ebd.) bis zu ihrer Vollendung in Jesus, dem Christus, verwirklicht ist.
IV. Die Juden im Neuen Testament
21. In den „Richtlinien“ wurde bereits (Anmerkung 1) gesagt, daß „der Ausdruck ,die Juden‘ im Johannesevangelium im Kontext bisweilen die ,Führer der Juden‘ oder ,die Feinde Jesu‘ bedeutet. Diese Ausdrücke sind eine bessere Übersetzung des Gedankens des Evangelisten, wobei der Anschein vermieden wird, als sei hier das jüdische Volk als solches gemeint.“ Eine objektive Darstellung der Rolle des jüdischen Volkes im Neuen Testament muß folgende verschiedene Gegebenheiten berücksichtigen:
A. Die Evangelien sind das Ergebnis eines langen und komplizierten Redaktionsprozesses. Die dogmatische Konstitution „Dei Verbum“ folgt der Instruktion „Santa Mater Ecclesia“ der päpstlichen Bibelkommission und unterscheidet darin drei Etappen: „Die biblischen Verfasser aber haben die vier Evangelien redigiert, indem sie einiges aus dem vielen auswählten, das mündlich oder auch schon schriftlich überliefert war, indem sie anderes zu Überblicken zusammenzogen oder im Hinblick auf die Lage in den Kirchen verdeutlichten, indem sie schließlich die Form der Verkündigung beibehielten, doch immer so, daß ihre Mitteilungen über Jesus wahr und ehrlich waren“ (Nr. 19).
Es ist also nicht ausgeschlossen, daß gewisse feindselige oder wenig schmeichelhafte Erwähnungen der Juden im historischen Zusammenhang der Konflikte zwischen der entstehenden Kirche und der jüdischen Gemeinde stehen. Gewisse Polemiken spiegeln Bedingungen wider, unter denen die Beziehungen zwischen Juden und Christen sehr lange nach Jesus bestanden.
Die Feststellung bleibt von grundlegender Bedeutung, wenn man den Sinn gewisser Evangelientexte für die Christen von heute herausarbeiten will.
All dies muß man in Betracht ziehen, wenn man die Katechesen und Homilien für die letzten Wochen der Fastenzeit und die heilige Woche vorbereitet (vgl. schon Richtlinien II., und jetzt auch Sussidi per l’ecumenismo della Diocesi di Roma, 1982, 142 b).
B. Auf der anderen Seite ist es klar, daß es vom Anfang seiner Sendung an Konflikte zwischen Jesus und gewissen Gruppen von Juden seiner Zeit, darunter auch den Pharisäern, gegeben hat (vgl. Mk 2,1–11.24; 3,6 usw.).
C. Es besteht ferner die schmerzliche Tatsache, daß die Mehrheit des jüdischen Volkes und seine Behörden nicht an Jesus geglaubt haben. Diese Tatsache ist nicht nur historisch; sie hat vielmehr eine theologische Bedeutung, deren Sinn herauszuarbeiten Paulus bemüht ist (Röm 9–11).
D. Diese Tatsache, die sich mit der Entwicklung der christlichen Mission, namentlich unter den Heiden, immer mehr verschärfte, hat zum unvermeidlichen Bruch zwischen dem Judentum und der jungen Kirche geführt, die seither – schon auf der Ebene des Glaubens – in nicht aufzuhebender Trennung auseinanderstreben; die Redaktion der Texte des Neuen Testaments, besonders der Evangelien, spiegelt diese Lage wider. Es kann nicht davon die Rede sein, diesen Bruch zu verringern oder zu verwischen; das könnte der Identität der einen wie der anderen nur schaden. Dennoch hebt dieser Bruch sicher nicht das geistliche „Band“ auf, wovon das Konzil spricht (Nostra Aetate, 4) und wovon wir hier einige Dimensionen ausarbeiten wollen.
E. Wenn die Christen sich hierüber Gedanken machen, und zwar im Lichte der Schrift und besonders der zitierten Kapitel des Römerbriefs, dürfen sie nie vergessen, daß der Glaube eine freie Gabe Gottes ist (vgl. Röm 9,12) und das Gewissen eines Mitmenschen sich dem Urteil entzieht. Paulus’ Ermahnung, der „Wurzel“ gegenüber nicht „in Hochmut zu verfallen“ (Röm 11,18), tritt hier sehr anschaulich hervor.
F. Man kann die Juden, die Jesus gekannt und nicht an ihn geglaubt oder der Predigt der Apostel Widerstand geleistet haben, nicht mit den späteren und den heutigen Juden gleichsetzen. Während die Verantwortlichkeit jener ein Geheimnis Gottes bleibt (vgl. Röm 11,25), sind diese in einer völlig anderen Lage. Das Zweite Vatikanische Konzil lehrt (Erklärung Dignitatis Humanae über die Religionsfreiheit), daß „alle Menschen frei sein müssen von jedem Zwang ..., so daß in religiösen Dingen niemand gezwungen wird, gegen sein Gewissen zu handeln, noch daran gehindert wird, … nach seinem Gewissen zu handeln“ (Nr. 2). Dies ist eine der Grundlagen, worauf der vom Konzil geförderte jüdisch-christliche Dialog beruht.
22. Das heikle Problem der Verantwortlichkeit für Christi Tod muß in der Sichtweise von Nostra Aetate, Nr. 4 und der Richtlinien und Hinweise III. betrachtet werden. Was während der Passion begangen worden ist, kann man – so Nostra Aetate, Nr. 4 – „weder allen damals lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden zur Last legen, obgleich die jüdischen Obrigkeiten mit ihren Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben“. Weiterhin: „Christus hat ... in Freiheit, um der Sünden aller Menschen willen, sein Leiden und seinen Tod aus unendlicher Liebe auf sich genommen.“ Der Katechismus des Konzils von Trient lehrt im übrigen, daß die sündigen Christen mehr Schuld am Tode Christi haben als die paar Juden, die dabei waren; diese „wußten“ in der Tat „nicht, was sie taten“ (Lk 23,34), während wir unsererseits es nur zu gut wissen (Pars 1, caput V, Quaestio XI). Auf derselben Linie und aus demselben Grund „dürfen die Juden nicht als von Gott verworfen oder verflucht dargestellt werden, als wäre dies aus der Heiligen Schrift zu folgern“ (Nostra Aetate, 4), auch wenn es wahr ist, daß „die Kirche das neue Volk Gottes ist“ (ebd.).
V. Die Liturgie
23. Juden und Christen finden in der Bibel die ganze Substanz ihrer Liturgie: für die Verkündigung des Wortes Gottes, die Antwort auf dieses Wort, das Lobgebet und die Fürbitte für die Lebenden und für die Toten, die Zuflucht zum göttlichen Erbarmen. Der Wortgottesdienst hat in seinem Aufbau seinen Ursprung im Judentum. Das Stundengebet und andere liturgische Texte und Formulare haben ihre Parallelen im Judentum genau so wie die Wendungen unserer verehrungswürdigen Gebete, darunter das Vaterunser. Die eucharistischen Gebete lehnen sich ebenfalls an Vorbilder der jüdischen Tradition an. Wie Johannes Paul II. (Ansprache am 6. März 1982) es sagte: „Der Glaube und das religiöse Leben des jüdischen Volkes, wie sie noch jetzt bekannt und gelebt werden, können dazu beitragen, bestimmte Aspekte des Lebens der Kirche besser zu verstehen. Das ist der Fall in der Liturgie ...“ 24. Dies zeigt sich besonders in den großen Festen des liturgischen Jahres, wie z. B. Ostern. Christen und Juden feiern das Pascha: das Pascha der Geschichte, in der Spannung auf die Zukunft hin, bei den Juden; im Tod und in der Auferstehung Christi vollendetes Pascha bei den Christen, wenn auch immer in der Erwartung der endgültigen Erfüllung (s. o. Nr. 9). Auch das „Gedächtnis“, mit spezifischem, in jedem einzelnen Fall verschiedenem Inhalt, kommt aus der jüdischen Tradition zu uns. Es gibt also auf beiden Seiten eine vergleichbare Dynamik. Für die Christen gibt sie der Eucharistiefeier ihre Sinnrichtung (vgl. die Antiphon O sacrum convivium): Sie ist eine Paschafeier und als solche eine Aktualisierung der Vergangenheit, aber gelebt in der Erwartung, „bis er kommt“ (1 Kor 11,26).
VI. Judentum und Christentum in der Geschichte
25. Die Geschichte Israels ist mit dem Jahr 70 nicht zu Ende (vgl. Richtlinien, III.). Sie wird sich fortsetzen, besonders in einer zahlreichen Diaspora, die es Israel erlaubt, das oft heldenhafte Zeugnis seiner Treue zum einzigen Gott in die ganze Welt zu tragen und „ihn im Angesicht aller Lebenden zu verherrlichen“ (Tob 13,4) und dabei doch die Erinnerung an das Land der Väter im Herzen seiner Hoffnungen zu bewahren (Pessach seder).
Die Christen sind dazu aufgefordert, diese religiöse Bindung zu verstehen, die in der biblischen Tradition tief verwurzelt ist. Sie sollten sich jedoch deswegen nicht eine besondere religiöse Interpretation dieser Beziehung zu eigen machen (vgl. die Erklärung der Katholischen Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten vom 20. November 1975). Was die Existenz und die politischen Entscheidungen des Staates Israel betrifft, so müssen sie in einer Sichtweise betrachtet werden, die nicht in sich selbst religiös ist, sondern sich auf die allgemeinen Grundsätze internationalen Rechts beruft.
Der Fortbestand Israels (wo doch so viele Völker des Altertums spurlos verschwunden sind) ist eine historische Tatsache und ein Zeichen im Plan Gottes, das Deutung erheischt. Auf jeden Fall muß man sich von der traditionellen Auffassung freimachen, wonach Israel ein bestraftes Volk ist, aufgespart als lebendes Argument für die christliche Apologetik. Es bleibt das auserwählte Volk, der gute Ölbaum, in den die Heiden als wilde Schößlinge eingepfropft sind (Johannes Paul II., Rede am 6. März 1982, unter Anspielung auf Röm 11,17–24). Man wird in Erinnerung rufen, wie negativ die Bilanz der Beziehungen zwischen Juden und Christen während zwei Jahrtausenden gewesen ist. Man wird herausstellen, von wie großer ununterbrochener geistiger Schöpferkraft diese Fortdauer Israels begleitet ist – in der rabbinischen Epoche, im Mittelalter und in der Neuzeit –, ausgehend von einem Erbe, das wir lange Zeit gemeinsam hatten, und zwar so sehr gemeinsam, daß „der Glaube und das religiöse Leben des jüdischen Volkes, wie sie noch jetzt bekannt und gelebt werden, ... dazu beitragen (können), bestimmte Aspekte des Lebens der Kirche besser zu verstehen“ (Johannes Paul II., Rede am 6. März 1982). Auf der anderen Seite müßte die Katechese dazu beitragen, die Bedeutung zu verstehen, welche die Ausrottung der Juden während der Jahre 1939–1945 und deren Folgen für dieselben hat.
26. Erziehung und Katechese müssen sich mit dem Problem des Rassismus befassen, der in den verschiedenen Formen des Antisemitismus immer mitwirkt. Das Konzil hat dieses Problem folgendermaßen dargestellt: „Im Bewußtsein des Erbes, das sie mit den Juden gemeinsam hat, beklagt die Kirche, die alle Verfolgungen gegen irgendwelche Menschen verwirft, nicht aus politischen Gründen, sondern auf Antrieb der religiösen Liebe des Evangeliums alle Haßausbrüche, Verfolgungen und Manifestationen des Antisemitismus, die sich zu irgendeiner Zeit und von irgend jemandem gegen die Juden gerichtet haben“ (Nostra Aetate, 4). Die „Richtlinien“ erläutern dies: „Die geistlichen Bande und die historischen Beziehungen, die die Kirche mit dem Judentum verknüpfen, verurteilen jede Form des Antisemitismus und der Diskriminierung als dem Geist des Christentums widerstreitend, wie sie ja auch bereits aufgrund der Würde der menschlichen Person an und für sich verurteilt sind“ (Einleitung).
VII. Schluß
27. Die religiöse Unterweisung, die Katechese und die Predigt müssen nicht nur zu Objektivität, Gerechtigkeit und Toleranz erziehen, sondern zum Verständnis und zum Dialog. Unsere beiden Traditionen sind miteinander so verwandt, daß sie von einander Kenntnis nehmen müssen. Man muß gegenseitige Kenntnis auf allen Ebenen fördern. Insbesondere ist eine peinliche Unkenntnis der Geschichte und der Traditionen des Judentums festzustellen, deren negative und oft verzerrte Aspekte allein zum allgemeinen Rüstzeug vieler Christen zu gehören scheinen.
Dem wollen diese Hinweise abhelfen. So wird es leichter sein, den Text des Konzils und die „Richtlinien und Hinweise“ getreulich in die Praxis umzusetzen.
Die Woche vor dem Fest Pauli Bekehrung wird in vielen Ländern der Erde als ökumenische Weltgebetswoche für die Einheit der Christen begangen. Dieser erhofften und uns aufgetragenen Einheit geht das Bedenken einer anderen Einheit voraus: Wir Christen sind als das neue Volk Gottes aufgesetzt auf die Wurzel und den Stamm des auserwählten Volkes. Darum halten Christen in mehreren Ländern Europas einen Tag des Judentums. In Österreich, Niederlande, Polen und Italien ist der 17. Januar, der Tag vor der Woche für die Einheit der Christen, dafür ausgewählt, in der Schweiz der 2. Fastensonntag. Die evangelischen Landeskirchen halten z.T. einen Israel-Sonntag.
Der Tag des Judentums steht einerseits im Dienst der jüdisch-christlichen Begegnung. Andererseits soll er helfen den christlichen Glauben zu vertiefen und die enge Beziehung der Kirche zum Judentum ins Bewusstsein heben. Christinnen und Christen sind eingeladen, an diesem Tag miteinander zu beten und Gottesdienst zu feiern.
Eröffnung
V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
A: der Himmel und Erde erschaffen hat.
V: Herr, öffne unsere Lippen,
A: damit unser Mund dein Lob verkünde.
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A: Amen.
Lied
Im Lied stellt sich unsere Gebetsgemeinschaft bewusst in die Gegenwart des einen und dreieinen Gottes, des Gottes Israels und der Kirche.
GLnr 381 (aGL 263): Dein Lob, Herr, ruft der Himmel aus (Str. 1-3)
oder GLn 385 (aGL 269): Nun saget Dank und lobt den Herren
GLnr 427 (aGL 289): Herr, deine Güt ist unbegrenzt
GLnr 144 (aGL 474): Nun jauchzt dem Herren, alle Welt
KG 550: Mein Auge schaut den Berg hinan
Vergebungs- und Versöhnungsbitte
V: In einer 2000-jährigen Geschichte haben Christinnen und Christen dem jüdischen Volk viel Gewalt angetan. Die Kirche hatte gelehrt, Juden und Jüdinnen sowie ihren Glauben zu verachten. Vor allem anderen wollen wir in diesem Gottesdienst für den Anti-Judaismus um Vergebung bitten.
A: Barmherziger Gott, wir bekennen, dass wir uns als Christinnen und Christen in der Geschichte immer wieder am jüdischen Volk schuldig gemacht haben. Das Erbe Israels haben wir als Kirchen in Jesus Christus angenommen, doch die geschwisterlichen Bande haben wir übersehen, ja geleugnet. Die Kirche hat sich an die Stelle Israels gesetzt. Im eigenen Glaubensstolz gefangen, waren wir wie mit Blindheit geschlagen. Viel unschuldiges, jüdisches Blut ist vergossen worden. Viel Hass haben wir gegen das jüdische Volk verbreitet. In Wort und Tat haben wir uns versündigt. Darum kommen wir vor dein Angesicht mit zerknirschten Herzen und mit reumütigem Sinn. Wir bitten um Erbarmen und Vergebung, um Versöhnung und Heilung.
V: Gott, König der Welt und Vater aller Menschen, wir sind als dein Ebenbild geschaffen. Du bist barmherzig und gnädig, langmütig, reich an Huld und Treue. Du erweist Tausenden deine Huld, lässt Schuld aber nicht ungestraft. Im Namen Jesu rufen wir deine Güte an:
Herr Jesus Christus, Sohn Davids, unter dem Gesetz geboren.
V/A: Kyrie eleison.
Du Lehrer und Vollender des nie gekündigten Bundes.
V/A: Christe eleison.
Erhöht zur Rechten Gottes wirst du in Herrlichkeit wiederkommen.
V/A: Kyrie eleison.
Der barmherzige Gott eröffne uns den Weg der Umkehr. Er heile unsere Wunden und vergebe unsere Schuld. Der Barmherzige nehme alles, was uns voneinander trennt. Er stärke das Band des gegenseitigen Verstehens und Achtens von Christen und Juden und führe uns in tiefe Gemeinschaft mit ihm. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. A: Amen.
Lesung aus der Hebräischen Bibel
Die Lesung erzählt von der besonderen Beziehung des jüdischen Volkes zu Gott und von seiner Berufung für die Menschheit: die Tora, das Wort Gottes, entgegenzunehmen, es zu leben und davon Zeugnis zu geben.
Ex 19,3-19; 20,1-11
(Kurzfassung: Ex 19,3-9; 20,1-11)
Psalm
Die Psalmen sind der gemeinsame Gebetsschatz des jüdischen Volkes und der Kirche. Sie bringen das Leben vor Gott zur Sprache und drücken die Glaubensüberzeugung in Gebetsform aus. Juden und Christen sprechen in den Psalmen mit Gott. Es ist ein geschwisterliches Zeichen von großer Kraft, wenn wir die gleichen Psalmen beten, auch wenn wir sie unterschiedlich deuten.
Ps 97 oder Ps 145 oder Ps 146.
Lesung aus dem Neuen Testament
Paulus schreibt von der bleibenden Erwählung Israels. Er staunt über das Geheimnis Gottes, dass Nicht-Juden durch Christus in diese Berufung hineingenommen werden. Dadurch wird sie vertieft und neu gestaltet. Es entsteht die Kirche an der Seite Israels, nicht an seiner Stelle. Paulus zeichnet das Bild des Ölbaums: Die Wurzel ist Abraham, der Stamm Christus, die am Stamm bleibenden Zweige sind die Judenchristen, die herausgebrochenen die Juden und die eingepfropften die Heidenchristen. Die Kirche ermahnt der Apostel zur Achtung vor den Juden und vor dem geheimnisvollen Wirken Gottes.
Röm 11,13-36
(Kurzfassung: Röm 11,25-36)
Halleluja
Halleluja ist ein althebräischer Jubelruf und Lobpreis Gottes. Wortwörtlich bedeutet er: Lobet JHWH! Der Gebetsruf ist Juden und Christen gemein. In der Liturgie zum Tag des Judentums darf er nicht fehlen!
GLnr: 174 oder 175
Evangelium
Die Evangelien sind urkirchliche Texte, die in der Logik der Hebräischen Bibel das Christusereignis immer tiefer zu verstehen suchen. Sie richten sich an Juden und Nicht-Juden und zeugen davon, dass die Offenbarung Gottes in Jesus Christus nur im Wahrheitshorizont des Alten Testamentes erschlossen wird, denn „das Heil kommt von den Juden“ (Joh 4,22). So ist Jesus in der Verklärung im Gespräch mit Mose und Elija. Der Berg der Verklärung verweist auf den Berg Sinai.
Mt 17,1-13
Anregungen für die Ansprache
Die Ansprache oder Predigt soll auf die An- und Abgrenzung sowie auf die bleibende Verwiesenheit von Judentum und Christentum eingehen. Mehr theologisch kann vom Alten und Neuen Bund gesprochen werden, mehr historisch von der reichen Geschichte der gegenseitigen Beeinflussung beider Glaubensgemeinschaften in allen Epochen, mehr therapeutisch und soteriologisch von der Aufarbeitung und Heilung der Wunden, die Christen Juden angetan haben. (Ein Verweis auf inhaltliche Hilfen steht am Ende des Beitrages.)
Lied
GLnr 397: All meine Quellen entspringen in dir (Kanon)
oder:
GLnr 423 (aGL 292): Wer unterm Schutz des Höchsten steht
GLnr 447,2: Die Gott suchen (Kanon)
GLnr 543 (aGL 614): Wohl denen, die da wandeln
KG 552: Öffne meine Augen, dass sie sehen
Fürbitten/Dank
V: Gott Abrahams und Saras, Isaaks und Rebekkas, Jakobs, Rahels und Leas! Gott des Mose und der Propheten, Gott Jesu Christi! Immer neu rufst du uns Menschen in deine Gegenwart. Dein Name ist JHWH, Ich-bin-der-ich-bin-da. So begleitest du uns auf unseren Wegen. Wir rufen vertrauensvoll zu dir:
Lass uns die Schuld anerkennen und umkehren, wo wir gegenüber dem Volk des nie gekündigten Bundes gesündigt haben.
V: JHWH-Gott. A: Wir bitten …
• Hilf uns, die eigene christliche Berufung im Angesicht des Judentums tiefer zu verstehen.
• Lehre uns, die Berufung der Juden zu verstehen und miteinander dem Reich Gottes entgegenzugehen.
• Bewahre die jüdischen Gemeinden auf der ganzen Welt, schenke ihnen Bestand und Wachstum in Frieden.
• Lass bei aller Verschiedenheit der beiden Glaubensgemeinschaften uns gegenseitige Gastfreundschaft gewähren, damit wir füreinander zum Segen werden.
• Reinige die Herzen aller Menschen von Rassismus und Antisemitismus, damit wir in jedem Menschen die Würde des Abbild Gottes erkennen.
• Verwandle uns alle von innen her, mach uns frei von Angst und hilf, alle Gleichgültigkeit zu überwinden.
• Stärke Juden und Christen in der ganzen Welt, auf dass sie sich gemeinsam für eine Welt in größerer Gerechtigkeit und wahrem Frieden einsetzen.
• Begleite die Verantwortlichen im Dialog von Kirche und Judentum weltweit mit deinem Segen.
• Steh allen Menschen in Israel und Palästina bei – Juden, Christen, Muslimen und Säkularen –, damit sie Wege zu Gerechtigkeit und Frieden finden.
• Lass alle Nationen und Völker von deiner Frohbotschaft durchdrungen werden, damit alle Enden der Erde dein Heil schauen.
Barmherziger Gott, du König der Welt und Vater aller Menschen. Erhöre unsere Gebete und begleite uns in dieser Zeit, auf dass wir in Dankbarkeit und voll Hoffnung dem himmlischen Jerusalem entgegengehen. Darum beten wir, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat:
A: Vater unser …
Segen
Gott, der aus dem Nichts das Universum erschaffen hat, wende sein Angesicht euch zu. A: Amen.
Gott, der aus dem Tod die Menschen zum Leben erweckt, lasse sein Angesicht über euch leuchten. A: Amen.
Gott, der durch Israel und die Kirche aus Sklaverei und von Götzen befreit, lasse sich von Angesicht zu Angesicht schauen. A: Amen.
Das gewähre euch der eine und dreieine Gott: der Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. A: Amen.
Danklied
GLnr 347 (aGL 249): Der Geist des Herrn erfüllt das All
Oder:
GLnr 384 (aGL 264): Hoch sei gepriesen unser Gott
GLnr 395 (aGL 261): Den Herren will ich loben
KG 141: Preis, meine Seele, Gott den Herrn
GLnr 551 (aGL 262): Nun singt ein neues Lied dem Herren
Weitere Hilfen
– Für den Tag des Judentums 2015 erscheint ein Handbuch für Seelsorgende (mit Beiträgen unseres Autors Christian Rutishauser SJ):
Schweizer Bischofskonferenz (Hg.), Jüdisch/Römisch-katholische Gesprächskommission: Wegleitung zum Tag des Judentums.
– Christian Rutishauser, Christsein im Angesicht des Judentums. Echter-Verlag Würzburg 2008. € 8,90.
Gemeinsamer Einzug - Orgelspiel
Eröffnung
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Alle: Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat. (Ps 121,1f)
Orgel & Lied
1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, / meine geliebete Seele, das ist mein Begehren. / Kommet zuhauf, / Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset den Lobgesang hören!
2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet, / der dich erhält, wie es dir selber gefällt; / hast du nicht dieses verspüret?
3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet,/ der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet./ In wie viel Not/ hat nicht der gnädige Gott / über dir Flügel gebreitet!
Schuldbekenntnis
Alle: Barmherziger Gott, wir bekennen vor dir, dass wir uns als Kirchen schuldig gemacht haben an deinem Volk Israel. Wir bekennen, dass Christinnen und Christen auch heute nicht wachsam genug sind, wenn Menschen wegen ihrer jüdischen Herkunft oder ihres Glaubens angefeindet und verachtet werden. Wir haben uns gerne die Gaben deines Volkes angeeignet – das Alte Testament, deinen Bund, den Gottesdienst und die Verheißungen. Wir bekennen, dass wir mit ihm selbst keine Gemeinschaft haben wollten. Mit tiefem Schmerz sehen wir die lange Spur an Blut und Tränen, an namenlosem Leid und Tod durch die Jahrhunderte, die Christinnen und Christen verursacht haben. Wir bitten dich um dein Erbarmen und deine Vergebung. Auch heute noch sind viele deiner Christinnen und Christen mit blind dafür, was du an deinem Volk und damit an allen wirken willst. Öffne uns die Augen für das Geheimnis deiner Wege. Wir bitten dich um dein Erbarmen und deine Vergebung.
Wo Schuld bekannt wird, ist Vergebung zugesagt.
Hört die frohe Botschaft der Vergebung, die Gott uns durch die Worte des Propheten zusagt: „Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden.“ (Jes 1,18)
Alle: Amen
Orgel & Lied
5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen./ Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen./ Er ist dein Licht,/ Seele, vergiss es ja nicht./ Lobende, schließe mit Amen
Gebet
Gott unser Vater, du hast die Welt erschaffen, du hast gegenüber Noa für immer deine Treue zur Schöpfung bekräftigt. Du hast dein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit und hast ihm Erlösung geschenkt. Du hast Israel erwählt, ihm deine Gebote gegeben und mit ihm einen Bund geschlossen. Dieser Bund hat ewig Bestand.
Du bist der Gott Abrahams und Saras, der Gott Isaaks und Rebekkas, Jakobs, Rahel und Leas, der Gott Moses’, Aarons und Mirjams, der Gott Davids und Salomos, der Gott von Ester, Judit und Rut, der Gott Jesu und seiner Mutter Maria.
Wir danken dir, dass dein Volk Israel und auch wir heute an deinen Heilstaten teilhaben dürfen, die du an den Vätern und Müttern des Glaubens und an ganz Israel für alle Völker offenbart hast.
Denn von Zion kommt die Thora, deine Weisung und dein Wort von Jerusalem, unter deinem Rechtsspruch stehen alle Völker.
Führe und begleite uns auf diesem Weg und gib uns Klarheit, mit Israel das Licht deiner Weisung zu erkennen und deinen heiligen Willen zu tun.
Alle: Amen.
Die Gemeinde erhebt sich!
1. Lesung: Exodus/2 Mose 19,3-8a
Psalm 111,1-10
2. Lesung: Römer 9,1-5
Halleluja - Orgel
3. Lesung: Lukas 2,25-32
Halleluja - Orgel
Predigt
Apostolisches Glaubensbekenntnis
Fürbitten
Gott, unser Vater, du hast Juden und Christen dazu berufen, von deinem Namen Zeugnis zu geben. Höre uns, wenn wir jetzt unsere Bitten vor dir aussprechen:
Für die jüdischen Gemeinden in unserem Land und in dieser Stadt: Herr, gib ihnen Bestand und Wachstum in Frieden.
Für Juden und Christen: Bewahre unsere Wege zueinander in Dankbarkeit für deine Treue zu deinem Bund.
Für Menschen verschiedener Völker und Religionen, die in diesem Bezirk leben, beten und arbeiten: Mache sie bereit, trotz kultureller und religiöser Unterschiede, einander anzunehmen und füreinander einzustehen.
Für die Kirchen: Dass sie die jüdische Wurzel, aus der sie wachsen und genährt werden, erkennen und davon Zeugnis geben.
Für die Menschen in Israel und Palästina: Wir hoffen und beten, dass Juden, Muslime und Christen Wege finden, damit sie in Gerechtigkeit und Frieden miteinander leben können.
Für alle Völker: Gott, erfülle deine Verheißung, dass alle Enden der Erde dein Heil schauen werden.
Für uns selbst: Herr, verwandle unser Herz und mache uns frei von Angst und Gleichgültigkeit. Hilf uns, dem Unrecht in jeder Gestalt entgegen zu treten.
Kollekte - Orgelmusik beim Einsammeln
Lied
Ich traue seinem Eid. Was er verspricht, das hält. / Auf Adlers Flügeln steige ich zum Himmelszelt. / Gott schauen werde ich, anbeten seine Macht; / ich rühm die Wunder seiner Gnad, die er vollbracht
Dem Himmel werd ich schauen in froher Seligkeit, / ein Land voll Frieden, freiheit und Gerechtigkeit, / wo Milch und Honig fließt und Öl und Wein gedeiht / und Frucht an Lebensbäumen reift zu jeder Zeit.
Erzengel loben Gott, der kommt und ist und war, / und „Heilig, heilig, heilig“ singt der Engel Schar. / Für Gott, der sagt Ich bin, sind wir zum Dienst bereit / und loben den Allmächtigen in Ewigkeit.
Schlusswort & Dank,
Einladung zur Agape
Vater unser
Segen
Num 6,24-26
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.
Der Herr hebe sein Angesicht über dich
und gebe dir Frieden Alle: Amen
Auszug - Orgelbegleitung
Was eine Fürbitte alles kann…
Ende 2016 erwähnte der Präsident des ICCJ, Philipp Cunningham, dass in seiner Pfarre die jüdischen Feiertage immer zum Anlass genommen werden, eine Fürbitte für das Wohlergehen der jüdischen Gemeinde auszusprechen. Dabei solle es nicht um ein Beten zur Bekehrung der Juden gehen, sondern darum, über die jüdischen Feiertage zu lernen und des jüdischen Lebens bewusst zu werden. Davon ließ sich der Diözesanbeauftragte für christlich-jüdische Beziehungen, Ferenc Simon, inspirieren. In Zusammenarbeit mit dem übrigen Vorstand des Koordinierungsausschusses formulierte er Fürbitten und Erläuterungen, die sich wie ein Lauffeuer über Facebook verbreiteten. Es begann zu Channukkah, das in 2016 genau auf Weihnachten fiel, und ging mit Pessach und Schawuot weiter. Wir möchten alle christlichen Gemeinden herzlich einladen, sich der Fürbitte anzuschließen und sie in den Gottesdienst aufzunehmen:
Rosch ha-Schana-Fürbitte
Am Beginn des jüdischen neuen Jahres, am Fest Rosch HaSchana, bitten wir Dich Allmächtiger/Gütiger/Herr, segne die Juden und Jüdinnen, wo immer sie sich aufhalten. Möge das Jahr 5786 gut und süß werden. Denke an uns alle, damit wir leben, und schreibe uns (für ein gutes Leben) ins Buch des Lebens ein.
Info: Das Neujahrsfest
Am 1. und 2. Tischri wird das Neujahrsfest begangen, das ein ernster Feiertag ist. Der Name Neujahr (Rosch ha-Schana) kommt in der Bibel nicht vor, und auch in den Gebeten dieses Festes ist kaum davon die Rede. Im Festsegen – und auch sonst – wird vom „Tag der Erinnerung“ oder „Tag des Posaunenschalls“ gesprochen.
Der Sinn des Neujahrsfestes liegt in der Erinnerung an den Bund, der zwischen Gott und Israel geschlossen wurde und der für die Israeliten eine sittliche Forderung und Verpflichtung darstellt. Der Tag soll dazu dienen, die Menschen zu veranlassen, in sich zu gehen, sich vom Bösen abzuwenden und gut zu handeln. Rosch ha-Schana ist der Tag, an dem der Mensch Rechenschaft über sein Tun ablegen und sich seiner moralischen Pflichten bewußt werden soll.
Als äußeres Instrument, den Menschen an seine moralischen Pflichten zu erinnern, dient die Posaune, der Schofar. Das ist ein Widderhorn, das im Morgengottesdienst nach der Tora- und Prophetenlesung sowie an mehreren Stellen des Zusatzgebetes in festgelegten Tonfolgen geblasen wird (außer wenn der Festtag auf einen Sabbat fällt.)
In vielen Gemeinden ist es Brauch, den Betraum für den Neujahrsgottesdienst besonders feierlich auszugestalten. Um die Erhabenheit des Tages zu betonen, pflegt in der Synagoge die weiße Farbe vorzuherrschen. Der Vorhang vor dem Toraschrank, die Decke auf dem Vorbeterpult und die Kleidung des Vorbeters sind weiß, im Gegensatz zu dem sonst Üblichen.
Rosch ha-Schana wird überall zwei Tage gefeiert, auch in Israel, wo bei den übrigen Festen die zweiten Tage entfallen. Der Kultus ist im wesentlichen an beiden Tagen identisch.
Die häusliche Feier des Neujahrstages besteht darin, daß dem Kiddusch und dem Segensspruch über das Brot noch ein Segen über Baumfrüchte angefügt wird. Man nimmt dazu einen Apfel, den man vor dem Verzehr mit Honig bestreicht, wobei man dem Wunsch Ausdruck verleiht, das neue Jahr möge gut und süß werden. Die Brote für das Neujahrsfest sind nicht wie sonst geflochten und länglich, sondern es ist üblich, rund gewickelte Weißbrote zu verwenden, um auf diese Weise den Jahreskreislauf zu symbolisieren.
Aus: Heinrich Simon: Jüdische Feiertage, Verlag Hentrich und Hentrich und Centrum Judaicum Berlin, 2003
Quelle: https://www.zentralratdjuden.de
Jom Kippur-Fürbitte
Zur Zeit des Versöhnungstages Jom Kippur bitten wir Dich, Gott, Dein zu Dir umkehrendes Volk Israel in Barmherzigkeit anzunehmen. Wende Dich auch uns Menschen zu in Milde und Liebe, erhöre unsere Bitten und besiegle den Eintrag im Buch des guten Lebens.
Info: Jom Kippur - Der Versöhnungstag
Den Höhepunkt der zehn Bußtage bildet der Versöhnungstag, der wichtigste Festtag des jüdischen Jahres. An ihm wird nach talmudischer Tradition das Urteil über den Menschen, das am Neujahrsfest, dem Tag des Gerichts, gefällt wurde, besiegelt und bekommt damit Gültigkeit. Der Versöhnungstag soll dazu dienen, den Menschen zu entsühnen, ihn die göttliche Verzeihung für seine Missetaten erlangen zu lassen. So ist der Versöhnungstag ein Tag der Reue, der Buße und Umkehr.
Dieser Tag ist ein strenger Fasttag, und zwar von Beginn des Festes am Abend bis zu seinem Ausgang am nächsten Abend. Weder Essen noch Trinken sind erlaubt; auch Körperpflege, mit Ausnahme des Benetzens der Hände und Augen mit Wasser, ist untersagt. Bevor man sich am Vorabend des Festes in die Synagoge begibt, entzündet man zu Hause ein Licht zum Andenken an seine verstorbenen Angehörigen, das 24 Stunden brennen soll. Manche pflegen auch eine Kerze im Vorraum der Synagoge aufzustellen. Es ist allgemein üblich, daß der Vorhang vor dem Toraschrank und die Decke auf dem Vorbeterpult weiß sind; auch die Torarollen befinden sich in weißen Hüllen. Die Betenden pflegen weiße Kleidung und eine weiße Kopfbedeckung zu tragen.
Der Abendgottesdienst, der noch bei Tageslicht beginnt, wird nach den Anfangsworten der ihn einleitenden Formel Kol Nidre (alle Gelübde) genannt. Dieser Text besteht in einer Erklärung, daß alle Gelübde und Schwüre null und nichtig sein sollen. Am Versöhnungstag dauert der Gottesdienst den ganzen Tag lang. Zu dem Morgengebet, dem festtäglichen Zusatzgebet und dem Nachmittagsgebet kommt noch ein nur an diesem Tag übliches Schlußgebet, an das sich dann nach Einbruch der Nacht das werktägliche Abendgebet und die Hawdala anschließen.
Im Anschluß an den Gottesdienst pflegt dann noch der Mondsegen im Freien stattzufinden, der im Tischri mindestens bis zu diesem Termin verschoben wird. Die Mahlzeit, die man nach dem langen Fasten einnimmt, wird als „Anbeißen“ bezeichnet; sie trägt einen festlichen Charakter, und man wünscht sich gegenseitig ein gutes Jahr und gute Besiegelung.
Aus: Heinrich Simon: Jüdische Feiertage, Verlag Hentrich und Hentrich und Centrum Judaicum Berlin, 2003
Quelle: https://www.zentralratderjuden.de
Sukkot-Fürbitte
Herr des Universums, als unsere Vorväter die Wüste Sinai (vor ihrem Eintritt in das Land Israel) durchquerten, umringten und überschwebten sie die wundervollen Wolken der Herrlichkeit und schirmten sie von allen Gefahren und Unannehmlichkeiten der Wüste ab. Seither gedenkt Dein Volk Deiner Güte und beteuert erneut sein Vertrauen in Deine Fürsorge, indem es während des Sukkot-Festes in Hütten wohnt. Sei Du ihm Schutz und Schirm.
Info: Sukkot - Laubhüttenfest
Am 15. Tischri beginnt das Laubhüttenfest (Sukkot), das dritte in den Reihe der Wallfahrtsfeste. Es dauert neun bzw. sieben Tage, da der achte Tag, das sogenannte Schlußfest (Schemini Azeret), als selbständiger Feiertag angesehen wird; der neunte Tag, der Torafreudenfest (Simchat Thora) heißt, ist der zweite Tag dieses Schlußfestes, der nur in der Diaspora begangen wird.
Sukkot ist das „Fest des Einsammelns“, ein Dankfest für das Einbringen der Ernte, vor allem der Obst- und Weinernte; zugleich erinnert Sukkot an die Wüstenwanderung der Israeliten nach ihrem Auszug aus Ägypten und an das Wohnen in unfesten Hütten während dieser Periode. Die doppelte Bedeutung des Festes symbolisiert einerseits der Feststrauß, der am Vormittag im Gottesdienst vewendet wird, andererseits das Gebot, während dieser Tage in einer Hütte (Sukka) zu wohnen.
Der Feststrauß (Lulaw) besteht aus einem Zweig der Dattelpalme, drei Myrten- und zwei Bachweidenzweigen, die zu einem Gebinde vereinigt sind, sowie aus der Zitrusfrucht, dem Etrog, einer Zitronenart.
Der erste und der zweite Tag Sukkot sind Feiertage, die darauffolgenden Tage (3. - 7. Tag) Halbfeiertage. Der siebente Tag hat allerdings eine besondere religiöse Bedeutung und führt einen eigenen Namen: Hoschana rabba. Dieser Tag gilt als Gerichtstag über das Wasser, als der Tag, an dem von Gott über den lebenden Regen beschlossen wird, der ja im Vorderen Orient nur während des Winterhalbjahres fällt.
Für Sukkot ist charakteristisch das biblische Gebot, in einer Hütte zu wohnen, einem unfesten Gebäude. Die Hütte muß so beschaffen sein, daß sie kein festes Dach besitzt; vielmehr ist sie mit Zweigen, Stroh und Reisig gedeckt, und zwar so dicht, daß bei Sonnenschein die schattigen Stellen im Innern überwiegen, und so locker, daß nachts die Sterne hindurchschimmern. Die Laubhütte wird möglichst wohnlich ausgestattet und schön ausgeschmückt. In unseren Breiten wird das Gebot, in der Hütte zu wohnen, insofern erleichtert, als nur die Mahlzeiten in ihr eingenommen werden sollen, denn es kann in dieser Jahreszeit ja bereits recht kühl sein.
Quelle: https://www.zentralratderjuden.de
Channukkah-Fürbitte
Wir beten für das Wohlergehen der Jüdinnen und Juden dieser Stadt. Sie zünden in diesen Tagen die Chanukka-Lichter als Erinnerung an den siegreichen Befreiungskampf der Makkabäer, die Wiedereinweihung des Tempels zu Jerusalem und all die Wunder, die der Ewige Seinem Volk Israel widerfahren hat lassen. Wir bitten Ihn Seine Hand weiter schützend über sie zu halten.
Info: CHANUKKA (LICHTERFEST)
"Chanukka ist das einzige jüdische Fest, das auf einen militärischen Sieg zurückgeht: den Sieg der Makkabäer gegen die hellenistischen Syrer im 2. Jahrhundert v.Z. Das achttägige Lichterfest Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des Tempels in Jerusalem, nachdem er entweiht worden war.
Der siebenarmige Leuchter (Menora) diente im Tempel als Ewiges Licht und wurde täglich mit hierfür abgezapftem und geweihtem Öl gefüllt. Dieses hatten die Eroberer Jerusalems ausgeschüttet, so dass bei der Wiedereinweihung zunächst kein Öl zur Verfügung stand. Das Öl in einem gefundenen Kännchen, das normalerweise für einen Tag reichte, brannte jedoch acht Tage, so lange, bis neues geweihtes Öl beschafft werden konnte. An dieses Ölwunder erinnert Chanukka, indem man nun an einem neunarmigen Leuchter (Chanukkija) jeden Abend eine Kerze mehr anzündet. Bei manchen orientalischen Juden ist der Brauch umgekehrt: Am ersten Abend werden alle acht Kerzen (+ »Diener«) und dann jeden Abend eine weniger angezündet.
Die Makkabäerbücher sind lediglich im Kanon des katholischen Alten Testaments überliefert und finden sich weder im evangelischen Alten Testament noch in der jüdischen Bibel (tanach). Zu den beliebten Bräuchen gehört es, in tiefem Öl gebratene Speisen zu essen (Krapfen, Kartoffelpuffer), kleinere Geschenke an die Kinder zu verteilen und mit einem Kreisel zu spielen.
Shawuot-Fürbitte
Wir beten für das Wohlergehen der Jüdinnen und Juden dieser Stadt. Sie feiern in diesen Tagen das “Wochenfest”, an dem sie sich dankbar an den Empfang der Torah am Berg Sinai erinnern. Dieses „Fest der Ernte“, der „Tag der Erstfrüchte“, die „feierliche Versammlung“ ist Freude über Dein Wort, das Leben ermöglicht. Behalte in deinem auserwählten Volk diese Freude über Dein Wort.
Info: WOCHENFEST
Am 6. und 7. Siwan findet das Wochenfest (Schawuot) statt. Es hat – wie die beiden anderen Wallfahrtsfeste – eine doppelte Bedeutung, eine auf die Natur bezogene und eine historische. In der biblischen Zeit war Schawuot nur das „Fest der Erstlinge“ und es wurden an diesem Tag im Jerusalemer Tempel zwei Weizenbrote geopfert, die aus dem Mehl der neuen Ernte hergestellt worden waren. Auch die Erstlinge anderer landwirtschaftlicher Produkte durften erst von Schawuot an als Opfer dargebracht werden. An dieses mit dem bäuerlichen Leben verknüpfte Fest der Erstlinge erinnert noch heute der Brauch, zu Schawuot die Synagogen mit frischem Grün und mit Blumen auszuschmücken.
Von weit größerer Bedeutung ist der religiös-historische Inhalt des Wochenfestes geworden. Nach der talmudischen Überlieferung ist Schawuot die Zeit der Verkündung der zehn Gebote am Berg Sinai, des ersten umfassend formulierten Sittengesetzes in der Geschichte der Menschheit, das sich auf eine als ewig gesetzte Norm gründet. Auf der Anerkennung dieser Gebote durch die Israeliten beruht der Bund zwischen Gott und dem Volke, das von Gott erwählt wurde, einen besonderen Auftrag zu erfüllen: die göttlichen Gebote zu befolgen und sie in der Welt zu verbreiten. Die Erwählung Israels, die Vorstellung von der besonderen Rolle der Juden besteht in der Erfüllung dieser speziellen Aufgabe, als ein heiliges, Gott verpflichtetes Volk zu leben, stellt also eine besondere Verpflichtung dar. In diesem Sinne ist die Formulierung „auserwähltes Volk“ zu verstehen, nicht aber bedeutet sie ein Vorrecht der Juden gegenüber anderen Menschen.
Quelle: https://www.zentralratdjuden.de
1670
Am Sonntag, den 26. Juli 2020 jährte sich die Vertreibung der Juden aus Wien im Jahr 1670, die „Wiener Gesera“, zum 350. Mal. Ich bitte daher alle Wiener Pfarren, in den Fürbitten der jüdischen Gläubigen in Wien zu Gedenken und dazu etwa folgende Fürbitte einzufügen:
„Den Juden wurde eine Frist bis 26. Juli 1670 gesetzt, um ihre Häuser zu räumen und Wien zu verlassen. Heute, nach 350 Jahren blüht in dieser Stadt wieder jüdisches Leben auf. Wir bitten Dich, Allmächtiger, Gütiger Herr: Segne die Jüdinnen und Juden dieser Stadt und ihre Gemeinden, gib ihnen Bestand und Wachstum in Frieden.“
Info: 1670
Am 26. Juli 1670, also vor genau 350 Jahren, mussten auf Befehl von Kaiser Leopold I. alle Juden Wien verlassen haben. Antijüdische Randale besonders der Wiener Studentenschaft, die Agitation von Geistlichen und von Bischof Leopold Karl von Kollonitsch, Unglücksfälle, für die ungerechterweise Juden verantwortlich gemacht wurden, die judenfeindliche Einstellung der Frau von Kaiser Leopold I., Margarita Teresa, wie auch die eines großen Teils der Wiener Katholiken und letztlich die Entscheidung einer kaiserlichen Kommission führten zu den Ausweisungsdekreten des Kaisers. An der Stelle der großen Synagoge des Ghettos im Unteren Werd wurde die Leopoldskirche im heutigen 2. Bezirk, der Leopoldstadt, errichtet. Ein sehr kleiner Trost mag der Gedanke sein, dass in den düsteren Jahren des NS-Terrors von 1938-1945 der damalige Seelsorger von St. Leopold, Pfarrer Alexander Poch, ständig bemüht war, jüdischen Menschen zu helfen und deshalb im Visier der Gestapo war.
Diese zweite, „Wiener Gesera“ genannte, Vertreibung der Wiener Judenschaft und die Zerstörung der jüdischen Gemeinde 1670 waren eine Katastrophe für die jüdische Bevölkerung und ein schmerzlicher Verlust für Wien. Die damaligen antijüdischen Wahnvorstellungen, wonach die Juden Feinde der Christenheit seien, deren heilige Schriften verhöhnen, die Brunnen vergiften, Hostien schänden, christliche Kinder stehlen würden etc., spielten bei den Wiener Vorgängen des späten 17. Jahrhunderts eine zentrale Rolle.
Die Ereignisse vor 350 Jahren können wir nicht ungeschehen machen, aber wir können sie zum Anlass nehmen, unsere Freude und Dankbarkeit darüber auszudrücken, dass es nach der Katastrophe der Shoah wieder jüdische Gemeinden und ein vielfältiges jüdisches Leben in Wien gibt. Dies ist ein Geschenk für Wien und für die katholische Kirche. Die katholische Kirche in Österreich hat sich mit allen anderen Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich (ÖRKÖ) die europäische „Charta Oecumenica“ von 2001 zu eigen gemacht, in der sich die Kirchen verpflichten, „allen Formen von Antisemitismus und Antijudaismus in Kirche und Gesellschaft entgegenzutreten; auf allen Ebenen den Dialog mit unseren jüdischen Geschwistern zu suchen und zu intensivieren.“
Ich danke allen, die sich für ein gutes Miteinander der Religionen in Wien einsetzen und wünsche Ihnen einen guten und friedlichen Sommer. Bitte beachten Sie auch die Corona-Anweisungen, damit das Virus sich nicht ausbreiten kann, und wir alle möglichst gesund bleiben.
Mit meinen herzlichen Segenswünschen
Ihr +Christoph Kard. Schönborn
Frequently Asked Questions
Read the answers to your questions.
First question about a service or something?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
What about the second question you want to ask?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Let’s put another question here, the good one?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
This is a very good question, I can’t pass on that?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim.
Have another question?
If you can’t find an answer to your question, please visit our Support page.
Get SupportLasst uns Gott lernen
Hosea 6,3-6
Info
Öffnungszeiten: Mo & Do 9-12
Koordinierungsausschuss für christlich-jüdische Zusammenarbeit
Tandelmarktgasse 5.
1020 Wien
+ 43 676 918 28 83
info(at)christenundjuden.org





